|
Das ORF-Funkhaus in der Argentinierstraße 30a steht vor dem Aus. Alle dort befindlichen Radiostudios sollen aus Kostengründen ins ORF-Zentrum auf den Küniglberg übersiedeln. Bei RadiomacherInnen und KünstlerInnen regt sich heftiger Widerstand, es wurde sogar eine Initiative gegründet, die den Ankauf des Funkhauses plant.
Gerhard Ruis von der IG AutorInnen hat gemeinsam mit dem Literaturhaus Wien eine Funkhausanthologie ins Leben gerufen, in der zahlreiche AutorInnen ihre Erinnerungen an dieses kulturelle Institution Österreichs festhalten. Auch ich bin seit heute mit einem Beitrag vertreten, den ich auch hier veröffentliche: Es war am 26. Oktober 1984, als ich zum ersten Mal in meinem Leben das Funkhaus in der Argentinierstraße betrat. Noch dazu war ich mit meinen damals 18 Jahren gleich auf der Bühne des Großen Sendesaals zu Gast, weil ich den von Radio Wien ausgeschriebenen Autoren-Wettbewerb in der Kategorie Hörspiel gewonnen hatte. Dieser Nationalfeiertag hatte mich kurz vorher bei der Angelobung in einer Wohnhausanlage im 23. Bezirk zum Soldaten gemacht und zeigte die Ambivalenz meines damaligen Lebens. Meinen achtmonatige Präsenzdienst beim Bundesheer hatte ich am 1. Oktober angetreten, weil ich mich nicht in der Lage fühlte, meinem Vater, der Berufssoldat war, entgegenzutreten und meinen Weg zu gehen. Den beschritt ich seit meinem 16. Lebensjahr mit Texten und Gedichten und eben jenem Hörspiel. Das handelte von einem Landjungen und einem Stadtmädchen, einer unglücklichen Liebe und dem Selbstmord des jungen Mannes namens Edi. Ich hatte dabei eine zweite Ebene eingeführt, in der mein Protagonist aus dem Jenseits sein Leben und die Ereignisse der letzten Wochen und Tage sozusagen von oben nochmals kommentiert. Es war eine gesellschaftskritische Abrechnung mit den handelnden Personen, die ich in echt so nicht zu Wege gebracht hatte. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, dass mein Text und die ihm innewohnenden Gedanken in die Welt hinaus übertragen wurden. Ich erlebte nach den beengenden Stunden des militärischen Vormittags, das ungemein belebende Gefühl der Freiheit. Mein Leben war aber auch in den nächsten Jahren noch viel von Konformität und Angepasstheit bestimmt, das Gegen-den-Strom-Schwimmen übernahm weiterhin meine dichterische Seite. Die aber spielte im Funkhaus dann keine Rolle mehr. Als ich Geschäftsführer einer großen österreichischen Familienorganisation war, wurde ich ins Studio einer Sendung auf Radio Niederösterreich eingeladen, in der es um die Arbeiterkammerkampagne “Stopp dem Kinderfang” ging. Dabei wurde den in Supermärkten in Kassennähe platzierten Süßigkeiten der Kampf angesagt. In der Call-in-Sendung gab ich meine Meinung zum besten und beantwortete HörerInnen-Fragen. Kurze Zeit später lud man mich zu einer Abendsendung zu Struwwelpeter und Erziehungsmaßnahmen ein, ich weiß nicht mehr ob es Radio NÖ oder Wien war. Erinnern kann ich mich noch an die sehr dichte Atmosphäre im Studio, es war offenbar ein heißes Thema und ich weiß noch, dass ich am Ende ziemlich verschwitzt und erschöpft und froh war, wieder an der frischen Luft zu sein. Die Pädagogik prägte ja dann sehr bald mein weiteres berufliches Leben - und die Gedanken über gelungene Erziehung bzw. die Zeitgemäßheit von Erziehung ließen mich nicht mehr los. Irgendwann später war ich nochmals bei einer Sendung von Lizzy Engster auf Radio Niederösterreich zu Gast und durfte meine Ferienwochen für Kinder im Waldviertel vorstellen. Das war mein letzter Auftritt im Funkhaus, dessen Atmosphäre sich aber tief eingeprägt hat. Vor kurzem erst hätte es beinahe ein weiteres Mal die Chance gegeben, im Funkhaus zu sein, aber ich musste den Termin mit den KollegInnen von Freak Radio aufgrund einer familiären Verpflichtung absagen. Dem Radio aber bin ich treu geblieben, gestalte ich doch seit etwas mehr als einem Jahr im freien Wiener Radio Orange eine monatliche Sendereihe mit dem Titel “Nie mehr Schule - das Magazin für alle, die Bildung verändern wollen”. Wie sich zeigt, ist es mit meiner Anpassung ans System mittlerweile vorbei und ich genieße nun endlich nicht nur dichterisch sondern auch beruflich, die Freiheit, die mir die erste Begegnung mit dem Funkhaus vor mehr als 30 Jahren verheißen hat. Das Funkhaus, das auf diese und jene Weise mein Leben geprägt hat, wird mir jedenfalls fehlen.
0 Comments
Wieder mal ein Krimi, der es in sich hatte; diesmal aus der Reihe "Polizeiruf 110". Unter dem Titel "Endstation" wurde da von einer Familie erzählt, die neben ihrer leiblichen Tochter noch drei Pflegekinder aufgenommen hatte. Gleich zu Beginn wird der jüngere Pflegesohn Opfer eines brutalen und tödlichen Überfalls. Das neu zusammengesetzte Ermittlerduo aus Magdeburg ist sich fast die gesamte Filmlänge über nicht grün. Das liegt an Hauptkommissarin Brasch, die selbst in seit ihrer Kindheit währende familiäre Turbulenzen verwickelt ist. Diese wirken auch in ihre gegenwärtige Familie, ihr Sohn wird in dieser Folge gerade aus dem Gefängnis entlassen und ist ob der nun einsetzenden Bemutterung alles andere als glücklich.
Die Handlung zeigt eine Fülle von Verstrickungen, in denen sich die vier Kinder und ihre Pflegeeltern sowie die leibliche Mutter der beiden Jungen befinden. Sie ist in ihrer Dichte und Tragik sehr schwer auszuhalten und eskaliert zum Schluss endgültig. Hier erleben wir hautnah die Überforderung einer Familie, die alles gut und besser machen wollte und letztlich an ihren eigenen Erwartungen zerbricht. Meine Frau und mich hat das zum Nachdenken über die Situation von Familien in unseren gegenwärtigen europäischen Geseslschaften gebracht. Wir kamen dabei vom hundersten ins tausendste, analysierten wohl treffend, fanden aber keine Patentlösung. Wie auch? Aus unserer Sicht jedenfalls ist es Tatsache, dass Familien zu wenig Unterstützung bekommen. Die Familienbeihilfe ist ein Sich-Freikaufen des Staates von Grundlegenderem, worüber noch zu sprechen ist. Die Gratis-Angebote von Kindergarten und Schule werden mit zwei Verpflichtungen verbunden: einerseits die Notwendigkeit, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, damit man finanziell überleben kann, andererseits die Kindergarten-, Unterrichts- und Ausbildungspflicht zwischen dem 5. (bald schon 4.) und nunmehr 18. Lebensjahr. Dafür werden die Eltern verantwortlich gemacht und müssen im Fall einer Nichterfüllung mit Strafen rechnen. Das ist keine Unterstützung, das ist Unterdrückung. Wer so unter Druck gesetzt wird, kann nicht der beste Vater, die beste Mutter für das/die Kind/er sein. Es läuft alles sehr subtil ab, da nicht offensichtlich werden darf, was hier durch das System an den Heranwachsenden verbrochen wird. Besonders dramatisch zeigt sich die Situation dann auch in Patchworkfamilien oder in Familien, in denen Misshandlungen passieren. Wenn der eine Elternteil die Kinder vor dem anderen beschützen will, dann wird von Seiten der Behörden gedrückt und gedroht - und so lange keine offensichtlichen Spuren von Missbrauch entdeckt werden, auch nicht eingegriffen. Das betrifft vor allem den emotionalen Missbrauch, der auch in aufrechten Familien gang und gäbe ist. Auch die Jugendwohlfahrt ist in ihrer Zwitterfunktion als Service- und Unterstützungseinrichtung sowie Kontrollinstanz heillos überfordert. Diese beiden Bereiche gehen einfach nicht zusammen, auch das zeigt Polizeiruf 110 in der Person des Jugendamtsmitarbeiters, der noch dazu die Kommissarin bereits aus ihrer Kindheit kennt. Das macht den Schlamassel perfekt. Hier ist keiner mehr frei, hier ist keiner mehr objektiv, hier ist keiner mehr hilfreich. Es ließe sich noch so viel zum Thema schreiben, aus eigener und zugetragender Erfahrung. In Summe zeigt sich - jedenfalls aus unserer Analyse -, dass die vor allem von konservativen Bewegungen und Parteien als "Keimzelle" der Gesellschaft bezeichnete Familie, trotz aller anderen Beteuerungen, immer noch im Regen stehen gelassen wird. Auf diese Weise wird eine "lost generation" nach der anderen produziert. Und denen, die es anders machen (wollen), nämlich abseits von staatlichen Zwangsinstitutionen und "Übervaterung", wird ein Stein nach dem anderen in den Weg gelegt (z.B. Anzeigen wegen Schulpflichtverletzungen, Unterstellung einer Gefährdung des Kindeswohls, etc.). Wie gesagt, wir haben keine Patentlösungen gefunden, aber wir wissen, dass es auch in diesem Bereich wohl eine Mischung aus Grundeinkommen für Familien und Unterstützung durch familienergänzende Menschen bräuchte. Wie heißt es so schön in einem vielzitierten afrikanischen Sprichwort: Es braucht ein ganzen Dorf, um ein Kind zu erziehen. Dem möchte ich für heute einmal nichts hinzufügen. Nun ist es also - vorerst - entschieden: Österreich ist ein gedritteltes Land. Das eine Drittel möchte gerne autoritäre Staatsführung, das zweite Drittel möchte lieber, das alles beim Alten bleibt, und das letzte Drittel scheißt drauf oder möchte etwas anderes, hat sich jedenfalls für keinen der beiden Kanditaten erwärmen können.
Ich gebe zu, die Rechnung stimmt nicht ganz und auch die Analyse mag zu kurz gegriffen sein. Das werden die nächsten Wochen zeigen. Zeigen wird sich auch, ob die FPÖ ihre Ankündigung, die Wahl anzufechten, wahr machen wird. Zuzutrauen ist es den antidemokratischen Freiheitlichen, die sich gerne als die wahren Demokraten aufspielen. Beim ersten Wahlgang, in dem ihr Kandidat weit vor den anderen lag, waren sie jedenfalls merkbar ruhig, was die Anzweiflung des Wahlergebnisses betrifft. Der siegreiche Alexander van der Bellen hat in seiner ersten Rede einerseits zur Versöhnung aufgerufen, in dem er allen "Lagern" ihre Existenzberechtigung zusprach und das "Wir" betonte, andererseits lehnte er es in einem Interview mit der ARD weiterhin strikt ab, einen Freiheitlichen unter den derzeitigen Bedingungen zum Bundeskanzler zu machen. Das ist meiner Erachtens ein Drahtseilakt, der nicht gelingen wird. Es ist Farbe über die Risse, die sich schon seit mehr als hundert Jahren durch dieses Land ziehen. Und es ist Schönfärberei der Tatsache, dass es immer noch salonfähig ist, nationalistisch und rassistisch zu sein, ja im schlimmsten Fall sogar mit dem Nationalsozialismus zu spielen. Dagegen wird alles was links der Mitte steht unter dem Generalverdacht des Kommunismus sofort diskreditiert. Nun bin ich kein Freund der Schubladen, weil ich ständig in welche gesteckt wurde - politisch decken diese Zuschreibung mittlerweile das gesamte derzeit verfügbare Spektrum ab. Ich hab mich - so wie viele andere auch - aber nie einkasteln lassen und werde das auch weiterhin nicht tun. Meine Intention sind sachliche, Parteigrenzen übergreifende Lösungen, die im Idealfall nicht bloß einen faulen Kompromiss sondern einen tiefgreifenden Konsens darstellen. Dazu ist es auch notwendig, dass die politischen Entscheidungen mit dem nötigen Blick auf's Ganze möglichst regional oder lokal getroffen werden. Das wäre Förderalismus at it's best. Doch ich befürchte, dass auch dieser Ansatz missverstanden werden könnte und ich in die nächste Schublade gesteckt werde - möglicherweise auch (je nach Betrachtungsweise) in verschiedene. Tatsache jedenfalls ist - das hat diese Bundespräsidentenwahl dem akribischen Beobachter gezeigt -, dass das von uns hochgehaltene System der Demokratie in seinr derzeitigen Verfasstheit nicht in der Lage ist, die Interessen der Menschen zu vertreten, geschweige denn sie zu einen; und das gilt weder für Österreich noch für Europa. Traurig aber wahr. Aber dennoch änderbar! Nun ist es also wirklich wahr, wir haben eine neue Bleibe gefunden. Der Weg dorthin war steinig - und viele der Steine habe ich mir diesmal selber in den Weg gelegt.
Das kam so: Knapp nach den Feierlichkeiten zu meinem 50er hat sich unser bisheriger Vermieter angesagt, um eine Evaluierung der Wohnung vorzunehmen. Der Mietvertrag, der auf 3 Jahre befristet war, sollte am 31. Mai dieses Jahres auslaufen. Nachdem ich dem Wohnungseigentümer auf seine Anfrage per E-Mail bereits mit einem Verlängerungswunsch geantwortet hatte, er aber - wie es so sein Art ist - auf mein Schreiben nicht reagiert hatte, war ich vor diesem Termin am 26.2. höchst aufgeregt. Tatsächlich kam der Mann dann in Begleitung eines Immobilienmaklers, um zu klären, wie viel er aus einem Verkauf seiner Eigentumswohnung lukrieren könnte. Kaum war der weg, kam ein Handwerker, um zu sagen, was denn alles umzubauen und zu sanieren wäre. Mir stockte in diesen langen Minutend er Atem, ich zog mich in die Küche zurück und trank dort ein Glas Wasser nach dem anderen. Als sich der Vermieter schließlich - ohne mir gegenüber nach der Begrüßung auch nur irgendein Wort verloren zu haben - zur Verabschiedung ansetzte, fragte ich ihn, ob er die Wohnung nun verkaufen wolle oder wir mit einer Verlängerung des Mietvertrages rechnen könnten. Er werde es mich per E-Mail wissen lassen, sagte er . In mir kochte extremer Widerstand gegen diese Veränderung auf, für mich kam die ganze Sache zur Unzeit, da ich an den zeitlichen und finanziellen Aufwand eines Umzuges dachte. Der Widerstand führte mich direkt in die Verzweiflung. In diesem Moment wurde meine Frau aktiv und organisierte übers Wochenende mehrere Wohnungsbesichtigungen. Ich empfand alles ganz nett, aber aufgrund des Ausnahmezustandes, in dem ich mich befand, konnte ich keiner der möglichen neuen Bleiben etwas abgewinnen, was mich bestärkt hätte, den Umzug zu wagen. Schon in diesen herausfordernden Tagen blitzte immer wieder die Idee auf, dass wir den Eigentümer der Nachbarwohnung fragen sollten, ob wir bei ihm anmieten könnten. Er war nämlich schon vor mehreren Wochen ausgezogen, hatte die Wohnung noch renoviert und unserem Jüngsten, der aus Interess gefragt hatte, mitgeteilt, dass nun die einen gehen und die anderen kommen. Dieses letzte Wort nahm ich sehr ernst und sah daher keine Chance für uns. Wenige Tage später kam das E-Mail unseres bisherigen Vermieters, in dem er uns einen neuen Mietvertrag in der gleichen Wohnung für weitere 3 Jahre anbot, bloß um einiges teurer. Wir überlegten - und hier machte ich den entscheidenden Fehler, weil ich nicht dem Leben vertraute, sondern immer noch im Widerstand gegen die nicht gewollte Veränderung gefangen war. Ich überzeugte meine Frau im Lauf einer Woche davon, das Angebot anzunehmen - und den Umzug um ein Jahr zu verschieben. Das entsprach der Mindestdauer des neuen Vertrages. Nun hörten wir viele Wochen nichts mehr. Meine Unsicherheit wuchs wieder. Dann kam jener Tag, an dem die Sprechanlagen im Haus getauscht wurden - und unser ehemaliger Nachbar war auch wieder da. Ich sprach ihn endlich darauf an, ob die Wohnung zur Miete stünde. Schon am nächsten Tag kam sein Vater, der der wirkliche Eigentümer der Nachbarwohnung war, und wir besichtigten die Räumlichkeiten und vereinbarten mündlich, die Wohnung ab 1.6. zu mieten. Die dabei ausgehandelten Bedingungen passten für beide Seiten wunderbar. Daraufhin sagte ich dem bisherigen Vermieter ab, der mir prompt die Honorarnote für den von ihm mit der Mietvertragserstellung beauftragten Anwalt übermittelte. Nach Rechtsauskunft bei zwei mir bekannten Juristen musste ich mich mit der Tatsache anfreunden, dass diese Vorgangsweise legal wäre. So versuchte ich den Anwalt zu erreichen und ihn von der Tatsache zu überzeugen, dass er in Kürze den gleichen Vertrag bloß mit geänderten Mieterdaten wieder verwenden könne. Er schweigt seither beharrlich, sei es weil er nicht auf den Vorschlag eingehen will oder sei es, weil er den juristischen Grundsatz "Wer schweigt scheint zuzustimmen" pflegt. Ich werde es spätestens bei der Wohnungübergabe Ende Mai wissen. Gestern dann, am 21.5. war es endlich soweit und ich konnte den Mietvertrag der neuen Wohnung unterschreiben. Gleichzeitig übergab uns unser neuer Vermieter die Schlüssel für die neue Bleibe und in gewohnter Schnelligkeit haben wir innerhalb von zwei Tagen unser neues Heim grundlegend eingerichtet. Wir können also schlafen und kochen - und ich habe meinen großen Schreibtisch, von dem aus ich nun auch diesen Text schreibe, mit Blick ins Grüne eingeweiht. Bleibt noch die Kleinigkeit alle Bücher und den Keller zu übersiedeln sowie die bisherige Wohung zur Übergabe in Schuss zu bringen. Dafür haben wir jetzt noch mehr als eine Woche Zeit. Und da wir nur 4 Stiegen runter müssen, sollte sich das ganz gemütlich machen lassen. Ich werde weiter berichten!
von Menschenseite zuerkennt. Nun habe ich vor einer Woche auf "willhaben" genau das Modell entdeckt, dass finanziell und vom Stil her zu mir passt. Eine Raketa-Uhr, gefertigt im legendären Uhrenwerk in Petrodworez am finnischen Meerbusen. Die/Der aufmerksame Leser/in wird den zusätzlichen Reiz für mich Finnophilen bemerken.
Die 24-Stundenuhr diente Polarforschern und Soldaten, um in der Dunkelheit der Polarnacht oder der unterirdischen Schützengräben den Tag-Nachtrhythmus beizubehalten. Neuere Modelle, so wie meines (siehe oben), das 1992 gefertigt wurde, haben eine zweite Zeitzone, die mit einer Krone bei "acht" eingestellt werden kann. 1962 wurde das Uhrenwerk, das 1949 in den Gebäuden einer früheren, von Katharina II. gegründeten Edelsteinschleiferei eingerichtet worden war in Raketa (Rakete) umbenannt. "Die Firma nannte sich ursprünglich nach der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution TTK-1 (Feiner Technischer Stein 1) und stellte vorwiegend technische Edelsteine, u.a. für Uhren, her. In den ersten Jahren wurden dort mit Teilen der 1. Moskauer Uhrenfabrik Rohwerke der Pobjeda und der Swjesda hergestellt. Ab 1954 wurden eigene Werke gefertigt und eingeschalt." (wie Wikipedia weiß) Den Namen Raketa erhielten die Uhren, weil ein Modell zu Ehren Juri Gagarins gefertigt wurde, der als erster Mensch in den Weltraum flog. Im Westen assoziierte man den Namen aber eher mit den Interkontinentalraketen, die im kalten Krieg zur Anschreckung eingesetzt wurden. Aus diesem Grund gingen sämtliche Mitarbeiter der Uhrenfabrik unter dem Motto: "Unsere Raketa verliert ihre großen Bruder" schwarzgekleidet zur Arbeit, als die UdSSR 1976 den Entschluss fasste, die R16-Langstrecken-Raketen zurückzuziehen. Wie bei allem, was Menschen in die Welt setzen, ist die Pervertierung des Eigentlichen immer schon mit angelegt und wird meist auch umgesetzt. So kann aus Uhren für Polarforscher und einen Astronauten auch die Ausstattung für Krieger und Soldaten oder die Patenschaft für Kriegsgeräte werden. Davon lass ich mich jedenfalls nicht abschrecken, weil ich ja weiß, warum ich diese Uhr mag. Außerdem trägt sie dem geflügeten Wort von der russischen Uhr, das ich von meinem Großvater kenne, Rechnung und geht regelmäßig innerhalb von 24 Stunden knappe 3 Minuten nach. Womit auch dieses Vorurteil bestätigt wäre .... P.S. vom 12.5.16: Kaum habe ich vom Nachgehen meiner russischen Uhr geschrieben, hat sie sich entschieden ab sofort um eine Minute vorzugehen. Zwei Nachmittage verbrachte ich beim vom Haus Bartleby organisierten Kapitalismustribunal, um meine Anklagen vorzutragen und mich mit anderen Anklagen zu beschäftigen. Diese Kunstaktion soll dazu dienen, dass Bewusstsein für die dem Kapitalismus zugeschriebenen Probleme entsteht und dass man diese für eine Lösung sozusagen an der Wurzel packt.
Der Theaterraum des BRUT im Künstlerhaus am Karlsplatz ist dafür in einen Gerichtssaal verwandelt worden, der seiner Aufgabe von Sitzordnung und Atmosphäre aus meiner Sicht absolut gerecht wird. Alle Anklagen, die in den letzten Wochen und Monaten über die Homepage des Tribunals eingelangt sind werden in dieser 1. Session, die vom 1.-12.Mai dauert verlesen. Ankläger kommen selbst zu Wort oder können sich von der Anklagevertretung repräsentieren lassen. Die Angeklagten haben alle eine Ladung erhalten, an den beiden Tagen, an denen ich anwesend war, kam aber keiner persönlich vorbei sondern vertraute auf die Dienste der Pflichtverteidiger, die ihre Sache sehr überzeugend machten. Es entstand bei deren Wortmeldungen immer der Eindruck, dass der Kapitalismus eigentlich eine gute Sache ist und die klagenden Menschen nicht so wehleidig sein sollten, immerhin profitieren ja soviel davon. Letzeres aber ist sehr in Zweifel zu ziehen, wenn man vor allem die Situation in Ländern betrachtet, die dem europäischen Kapitalismus zuarbeiten. Das bewies eine Liveschaltung nach Peru eindrucksvoll, in der betroffene MinenarbeiterInnen zu Wort kamen, um ihre finanzielle und gesundheitliche Situation zu schildern. In diesen Augenblicken wurde mir bewusst, dass das Tribunal in seiner Wirksamkeit auch falsch verstanden werden könnte. Es handelt sich - wie schon gesagt - um eine Kunstaktion zur Bewusstseinserweiterung und nicht um Gerichtsverfahren im legistischen Sinn. Nicht immer war ich mir sicher, ob sich die AnklägerInnen und ihre ZeugInnen dieser Tatsache bewusst waren. In diesem "Vorverfahren" wurde von den dem Tribunal vorsitzenden RichterInnen entschieden, ob eine Anklage zum Hauptverfahren, das im November wieder in Wien stattfinden wird, zugelassen wird. Abschließend möchte ich noch den freischaffenden Philosophen Bertrand Stern zitieren, mit dem ich zum Thema Kapitalismus und Bildung ein ausführliches Telefongespräch geführt habe. Er sprach sich ganz klar gegen jegliche Form des "-ismus" aus und plädierte für eine anarchische Gesellschaftsordnung im besten Sinn des Wortes (also nicht für deren Perversion im Anarchismus). Ein intensiver Feiertag, dieser 5. Juni 2016. Dessen Bezeichnung Christi Himmelfahrt hat mich zum Titel meines heutigen Tagebucheintrages animiert, obwohl ich mit den Aufgaben, die ich da heute erfülle, nicht unbedingt in Lebensgefahr geraten werde.
Gerade bereite ich mich auf mein Auftreten beim Kapitalismustribunal im Brut Wien am morgigen Freitag und am kommenden Samstag vor. Da werde ich meine Anklagen bezüglich Bildung und Existenzsicherung einbringen. Alle können diese persönlich vor Ort oder via Livestream unterstützen. N21, bei dem ich Mitglied der Redaktion bin, hat dazu im Vorjahr mit Henrik Sodenkamp, einem der InitiatorInnen, ein Interview geführt. Dann steht die Endkorrektur meines Beitrages für den diesjährigen FM4-Wortlaut zum Thema „Fallen“ an, der noch heute bis um Mitternacht an die Redaktion geschickt werden muss. Auf Facebook habe ich mit meinem Eintrag zu Servus-TV („Papa Bulle hat's gerichtet. Kein Betriebsrat daher weiter ServusTV von Mateschitzens Gnaden. :-P“) eine heftige Diskussion angestoßen und auch an anderer Stelle zur Dikussion um die Vorgangsweise von Dietrich Mateschitz beigetragen. Tatsache ist, dass heute Menschen viel mehr ihres (Un-)Glückes Schmied sein wollen als früher. Das dem so ist, dafür hat sicher auch die Gewerkschaft gesorgt, die in einer indvidualisierten Gesellschaft weiterhin sehr kollektiv vorgeht. Diese Individualisierung hat aber auch genau dazu geführt, dass dieses Wirtschaftssystem so funktioniert. Menschen wie Herr Mateschitz sind dessen authentische Verkörperung, aber auch dessen SymptomträgerInnen. Wir alle aber haben es in der Hand, das System zu ändern und damit auch den Herrn über Red Bull – aber bitte nicht in umgekehrter Reihenfolge. Zu dieser Vorgangsweise gibt es die Geschichte von der Hydra. Zudem denke ich, dass es höchste Zeit für eine bedingungslose Grundsicherung in existenzsichernder Höhe ist. Auf dieser Basis kann sich jedeR wirklich möglichst frei bewegen und entscheiden was und unter welchen Bedingungen er/sie arbeiten will. Mein Septiarium, das ich seit Mitte März regelmäßig als persönlichen Wochenrückblick veröffentlicht habe, ist in eine Art Midlife-Crisis geraten und hat daher seit dem vergangenen Wochenende eine Pause eingelegt. Ich sinne darüber nach – auch heute – wie ich den Inhalt von einer Zusammenfassung der Bad News zu einer solchen über die Good News umgestalten kann. Das wird wahrscheinlich noch (eine) weitere Woche(n) dauern. Auf die bisherige Art hat es mir viel Schreibkraft gekostet und war doch bloß eher eine Zusammenfassung der Scheußlichkeiten mit fragwürdiger Wirkung. Und bewirken soll es jedenfalls etwas, nämlich, dass dich jedeR LeserIn dessen bewusst wird, welche Möglichkeiten bestehen, um die Welt zu verändern; von den Notwendigkeiten weiß eh einE jedeR. Daher: Good News! Gestern abend habe ich mit Reetta dem ORF-Livestream gefrönt – mit den bekannten Schwächen: das nämlich immer dann, wenn es besonders unpassend ist (gibt es überhaupt einen passenden Moment?), Pause war. Muss mich jetzt noch mal schlau machen, ob ich für das Fernsehen am Laptop tatsächlich Fernsehgebühren bei der GIS zahlen muss. Im Hinterkopf habe ich da ein OGH-Urteil – oder ist es erst ein Verfahren? – das die Bezahlung dieser Gebühren an ein Fernsehgerät oder eine SAT-Empfangsanlage koppelt … Nun zum Gesehenen: ein Heimatfilm der Moderne, der exzellente SchauspielerInnen unter einem nichts sagenden Titel (Die Fremde und das Dorf) mit einem spannenden Plot zu eindrucksvollen Leistungen auflaufen lässt. In Tragöß in der Steiermark liegt tatsächlich eine Leiche im Keller und durch den Besuch einer Lehrerin aus Italien, die dort mit ihrer Schulklasse einen Erholungsurlaub nach einem Erdbeben verbringt, bleibt auch in dem beschaulichen steirischen Ort kein Stein auf dem anderen. Sehenswert! Aber leider – wie ich gerade feststellen musste - entgegen den Angaben auf der ORF-Homepage nicht in der TV-Thek zu finden. Nun lacht die Sonne beim Fenster herein, die gestrigen etwas mehr als 10 Grad werden heute vom Wetter verdoppelt und ich habe Lust noch eine Runde am Wienfluß zu drehen, bevor ich mich wieder den oben beschriebenen Tätigkeiten widme. Himmelfahrt hin oder her … Mit „Arbeit“ beschäftige ich mich seit ich denken kann. Er ist mir in so vielen Variationen untergekommen, dass ich mich wundere, dass es nur einen Begriff dafür gibt. Da war die Tätigkeit meines Vaters als Berufssoldsat, die Beschäftigung meiner Mutter mit ihrer Schneiderei, die sie als Meisterin ihres Faches bloß zuhause ausübte, die Nebenbeschäftigung meines Großvaters, der als pensionierter Geldbriefträger in der Postabteilung des KURIER seine Rente aufbesserte und schon bald meine Schularbeiten, eine nach der anderen, neun lange Jahre lang.
Als Betriebsrat, der ich in meiner ersten beruflichen Station, einer Bank, 4 Jahre lang war, kam ich mit den philosophischen und realpolitischen Ausführungen zum Thema Arbeit in Berührung. Da gab es den herben Witz über einen Personalchef, der neben seinem Namensschild am Schreibtisch ein weiteres Schild stehen hatte. Diese war vorne und hinten beschrieben. Sein Gäste lasen: „Der Mensch als Mittelpunkt“, er selbst sah die Aufschrift: „Der Mensch als Mittel.“ (Punkt!) Ich lernte die christliche Soziallehre und ihre Vorstellung von Arbeit kennen und auf zahlreichen Seminaren der Gewerkschaft kam ich mit der linken Interpretation des Begriffes in Berührung. Erhellend fand ich die Umkehrung der Begriffe Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Demnach sind jene, die einem Unternehmen ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, die die ihre Arbeit geben, also die Arbeitgeber und die anderen, die deren Arbeitskraft nehmen die Arbeitnehmer. Dieses Spiel mit den Begriffen schafft es aus meiner Sicht immerhin die Gräben zwischen den beiden Seiten, die doch ein gemeinsames Interesse haben, zu schließen – oder reißt es möglicherweise neu auf? Die Reduktion von „Arbeit“ auf Erwerbsarbeit ist jedenfalls ein großes Problem für mich. Die Physik definiert den Begriff ja grundlegender – und diese Definition täte der Erweiterung der Perspektive auf Arbeit wahnsinnig gut; vor allem im Hinblick auf die Tatsache, dass nur Erwerbsarbeit eine Existenz sichern kann. Alle sozialen Maßnahmen wurden rund um sie herum geschaffen. Immer ist einer der seine Erwerbsarbeit los ist, auch in eklatanter Gefahr seine Existenzberechtigung zu verlieren. Diesem Unfug muss dringend ein Ende gesetzt werden. Wenn ich mein Leben betrachte, so ist es voll von sinnstiftender Arbeit. Dafür verdiene ich gerade mal so viel, dass ich meinen Beitrag zum Erhalt meiner Familie leisten kann. „Nie ist zu wenig, was genügt!“, lässt Heini Staudinger die Weisheit seiner Großeltern hoch leben, und recht hat er. Was mich allerdings betroffen macht ist die Tatsache, dass ich derzeit in diesem Leben einen Existenzkampf von Monat zu Monat ausführen muss. Das erinnert stark an die Steinzeit – und doch befinden wir uns im 21. Jahrhundert und im angeblich sozialsten aller Zeitalter. Irgendetwas aber stimmt dennoch nicht. Denn ich bin mit diesem Gefühl nicht allein. Eine wachsende Zahl von Menschen kämpft Tag für Tag um ihr Existieren-Dürfen (Stichworte: Prekariat, Mindestsicherung) – und das ist absolut nicht nur Frage der (Aus-)Bildung, wie man uns weis machen will. Im Hinblick auf die nächste „industrielle Revolution“, die innerhalb des nächsten Jahrzehnts durch Automation bis zur Hälfte der momentan verfügbaren Arbeitsplätze kosten könnte, sind Arbeit und Existenzberechtigung dringend zu entkoppeln. Das bedingungslose Grundeinkommen ist dafür aus meiner Sicht ein probates Mittel. Es würde außerdem dazu führen, dass niemand mehr unwürdige Arbeit oder Arbeit unter unwürdigen Bedingungen annehmen müsste. Auf die Worte, die dies verkünden, warte ich am 1. Mai Jahr für Jahr vergeblich. Stattdessen bekriegt man sich in der einstigen Arbeiter-Partei an dem einst so hohen Feiertag, ob man mit den Blauen koalieren sollte oder nicht. Ein Trauerspiel, dem die Katharsis hoffentlich bald folgt. Abschließend möchte ich – wie immer, wenn ich zu diesem Thema schreibe – auf Erich Fromms kluge Gedanken aus meinem Geburtsjahr 1966 hinweisen. Wir dürfen getrost davon ausgehen, dass alle psychisch und physisch gesunden Menschen – trotz Grundeinkommens – einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen werden und nicht bloß faul vor der Glotze sitzen werden. Im Hinblick auf die zunehmende Anzahl von Menschen, die – auch schon in jungen Jahren- nicht mehr gesund sind, halte ich in dieser Sache aber Eile für dringend geboten. Ein Hoch dem 1. Mai! Ein Hoch auf die Arbeit des 21. Jahrhunderts! |
Hinweis:
Meine Meinung zu aktuellen Themen habe ich bis 1.9.2015 im Blog "Mein Senf zu allem" veröffentlicht. Seither habe ich sie auf dieser Seite in meine Tagebucheinträge integriert.
Archiv
Juli 2019
|
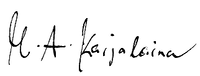

 RSS-Feed
RSS-Feed
