|
Entmenschlichung
Jeden Morgen wieder. Im Winter dunkel. Kalt. Das Frühstück schmeckt nicht, noch dazu findet es unter Zeitdruck statt, weil das Aufstehen knapp nach 6 Uhr morgens so schwer fällt. Schwer ist auch die Tasche, in der die Arbeitsmaterialien für den Tag drinnen sind, weit über 10 Kilo in Büchern und Heften verpacktes Wissen. Dazu die Jause und eine Trinkflasche. Die Haltung, schon vorher leicht gebückt, noch ein wenig gekrümmter als er knapp vor 7 aus dem Haus schleicht. Eine Junge eben, meinen seine Eltern, vorpubertär, also eigentlich nicht schulkompatibel. Da müssen wir durch. Schulbus um 7.02, nach neunzehn Minuten ist er in der Stadt, wo es um 7.45 Uhr losgeht, fünf oder sechs Stunden lang, montags sogar acht wegen Mathe-Fördern. Heimkehr dann meist gegen 14 Uhr, am Montag erst um 16 Uhr. Das Mittagessen schon kalt. Der Hunger nicht mehr vorhanden. Glücklicherweise haben die KollegInnen immer etwas Süßes oder Salziges mit, damit das Leben ein wenig fröhlicher wird. Glücklicherweise rennt auch ein guter Schmäh, damit die Tage nicht so düster sind. Glücklicherweise gibt es auch die eine oder den anderen Lehrende/n, die/den man gut verarschen kann. Unbewusste Auflehnung gegen ein System, das niederdrückt, dem man auf diese Weise ein bisschen etwas zurückgeben kann von seiner Entmenschlichung. Der Nachmittag, eigentlich voll mit Hausübungen, Prüfungs- und Schularbeitsvorbereitungen führt in die Welten von Musik und Survivor Dogs. Die mahnenden Worte der Eltern: Noch einmal abgeblockt, noch einmal den Ärger verschoben. Und: Vielleicht ist das Glück doch auf seiner Seite und es geht sich die Vier aus, die das Mindestmaß ist. Mehr muss es nicht sein, sagt die Mutter. Es darf schon ein bisserl mehr sein, der Vater. Ab und zu gelingt es auch, die Zeit in der Stadt zu verlängern, im Jugendtreff, wo man auch Hausübungen machen kann, aber nicht muss. Wo man aber eine ganze Menge Möglichkeiten hat, sich vom Leben abzulenken, von diesem Leben aus Pflicht und Takt und Interesselosigkeit. Kein Platz für ihn. Aber so ist das eben, sagen die Eltern, auch wir haben Pflichten, auch wir dürfen nicht tun und lassen, was wir wollen. Dafür gibt’s die Wochenenden, dafür gibt’s Urlaub, dafür gibt’s die Pension. Wenn wir sie noch erleben, so der Vater manchmal sarkastisch, dann, wenn er das eine Glas zu viel getrunken hat am Wochenende. Und wenn wir es uns leisten können, nicht mehr zu arbeiten. Mutter spielt Lotto. Vater zockt manchmal im Wettcafé. Nur kleine Beträge. Aber die summieren sich auch. Davon hätten wir uns schon das neue Sofa kaufen können, so die Mutter. Und der Vater: Aber wenn ich einmal gewinne, können wir uns ein Haus kaufen mit allem Drum und Dran. Eine Welt der Pflichten entrechtet die Menschen, nimmt ihnen jedes Recht, führt sie weg vom Menschsein. Eine Welt der Rechte hingegen, verpflichtet die Menschen, um ihre Rechte erhalten zu können. Nur das ist der Weg. Doch die allgemeine Schulpflicht wurde nicht dazu gemacht, um allen Bildung zu ermöglichen. Sie ist kein Recht. Sie ist das jede/n verpflichtende Machtinstrument der Herrschenden, sich ihre Diener, ja ihre Sklaven zurecht zu modeln. Alle „gestüm“ (Zitat: Puh, der Bär, Tigger is unbounced) zu machen. Und für ihre Sache zu verwenden, am Arbeitsmarkt, beim Konsum, bis hin zum Krieg. Wenn wir aber nicht mehr mitspielten, dann … … dann sind wir draußen, fallen aus allen Sicherheiten, … dann sind wir dem Freiheitswahn auf den Leim gegangen, … dann sind wir kein Teil der Gesellschaft mehr, ja fast Staatsverweigerer. Doch wenn wir wirklich nicht mehr mitmachten, dann … … dann könnten wir in Freiheit dem nachgehen, was uns wirklich interessiert und damit alle, die in dieser Gemeinschaft leben voneinander profitieren, … dann könnten wir wirklich eigenverantwortlich, kreativ und lösungsorientiert die Gegenwart erfahren und eine lebenswerte Zukunft schaffen, … dann könnten wir gesund und furchtlos unseren Lebensaufgaben folgen und somit erfolgreiche Menschen sein. Der Junge träumt manchmal nachts von einem Leben, das ihm völlig fremd ist, von Wolken, auf denen er liegt, von Wassern, auf denen er geht, von Himmeln, in denen sein Dasein leicht und lebendig ist. Oft wacht er dann schweißgebadet auf und ist froh wieder den guten alten Boden unter den Füßen zu haben und die Sicherheit, mit denen er täglich erfährt: So ist es eben, das Leben.
0 Comments
„ ‚Wenn die Menschen wüssten, was der Tod ist, dann hätten sie keine Angst mehr vor ihm. Und wenn sie keine Angst mehr vor ihm hätten, dann könnte niemand ihnen mehr die Lebenszeit stehlen. … Ich sage es ihnen mit jeder Stunde, die ich ihnen zuteile. Aber ich fürchte, sie wollen es gar nicht hören. Sie wollen lieber denen glauben, die ihnen Angst machen.‘ “ (Michael Ende, Momo) Alles hat seine Zeit. Jede/r hat seine/ihre Zeit. Kairos. Chronos.
Gestern Abend war es wieder soweit. So wie seit zwei Wochen an jedem Sonntag nach dem Einbruch der Abenddämmerung ziehe ich die kürzlich erstandene Junghans-Küchenuhr mit dem dazugehörigen Schlüssel auf. Auf diese Weise wird die Zeit für die kommende Woche aufgeladen, das Uhrwerk läuft mindestens acht volle Tage, wobei ich ihm – wie geschrieben – bereits nach 7 Tagen wieder einen Schubser gebe. Für mich ist dieser Vorgang vom ersten Mal an ein Ritual gewesen. Es gilt der abgelaufenen Zeit zu gedenken und die Kraft der zukünftigen Sekunden, die die Uhr durch ihr eindringliches Ticken laut in den Raum wirft, zu erspüren. Genau das führt mich in die Gegenwart, die einzige Zeit, die tatsächlich existiert. Jetzt. Käme ich keinen Moment ins Aus-dem-Augenblick-Stolpern, ich wäre einer, der tatsächlich ist. Aber diese Kunst ist mir trotz des halben Jahrhunderts, das ich nun schon diese Welt belebe, noch nicht zu eigen. So war ich, werde sein, könnte, sollte, wollte, möchte, müsste, dürfte … und bin so selten. Zudem steht mir ja auch meine Endlichkeit im Weg, deren Grenzen ich schon auf die eine oder andere Weise zu sprengen suchte – ohne Wirkung. Immer wieder bekam und bekomme ich eine Ahnung davon, was Zeit tatsächlich ist, verlasse meinen Chronos, spüre meinen Kairos auf, ohne ihm dauerhaft gewahr zu werden. Zumindest diese Ahnung ist. Schnell falle ich zurück ins Menschenmögliche, in dem die Tage zu meinem Bedauern gezählt sind. Mag sein, dass es auch in meinem Leben den Augenblick geben wird, den Kairos, in dem ich erkenne, dass es genug ist. Voll. Erfüllt. So wie in diesen Momenten, in denen ich aus dieser Zeit falle, um einen Moment lang der Ewigkeit zu fröhnen, wie sie gemeint ist. Das Aufziehen der Junghans-Küchenuhr an jedem Sonntagabend ist mein wöchentliches Exerzitium am Weg dorthin. #eslebedaslandleben – mein Hashtag auf Twitter und Facebook, um den großen Schritt zu zelebrieren, den meine Familie und ich nun nach jahrelangem Zögern mit dem Jahreswechsel endgültig vollzogen haben, hat den einen oder die andere dazu gebracht, nachzufragen, wo denn nun unser ländliches Domizil sei.
Und da begannen sich auch gleich die Geister zu scheiden, was denn nun als Land zu gelten habe und was nicht. Nun, wie auch immer man zu der Gegend stehen mag, in der meine Familie und ich nunmehr leben, für mich, für uns ist es das Land – mit dem Vorzug der unmittelbaren Anbindung an eine Kleinstadt, die auch einmal Chancen darauf hatte, die Hauptstadt von Niederösterreich zu werden. Tatsache ist, dass der Ort, den ich zu meinem Lebensmittelpunkt erkoren habe, geprägt ist von den Winzer- und Bauernhöfen, die hier viele Jahrzehnte lang das Ein- und Auskommend er Menschen sicherten. Mittlerweile ist dem nicht mehr so. Viele fahren zur Arbeit in die Gegend, die Landeshauptstadt oder gar nach Wien. Manch einer ist Nebenerwerbslandwirt geblieben, ermöglicht vor allem dort, wo Eltern und Schwiegereltern kräftig mithelfen. Knappe zwei Kilometer nordwestlich vom von uns gemieteten Winzerhof liegt der Bahnhof des Ortes, ein paar hundert Meter südöstlich das Gewerbegebiet der nahen Stadt, das die üblichen Einkaufsmöglichkeiten vom Baumarkt über den Lebensmittelhandel bis zum Erotik-Shop bietet. Das ist eine andere Welt, in die ich – so notwendig – das eine oder andere Mal einen Ausflug wage, um das zu besorgen, was ich brache um unser Haus in Schuss zu bringen oder jene Lebensmittel zu ergattern, die vor Ort nicht zu bekommen sind. Und dann, wenn ich die Straße in unsere Ortschaft nehme, das Ende der Stadt und wenige Meter später den Anfang unseres Dorfes passiere, dann fällt mit einem Atemzug die städtische Hektik des Einkaufszentrums ab und ich bin zuhause. Ein paar Häuser weiter ist es ja dann tatsächlich so, dass ich das große Eingangstor des Hofes aufsperre, mein Fahrrad im überdachten Eingangsbereich abstelle und das Eigekaufte in unsere geräumige Speis, die gleichzeitig auch Abstellraum ist, bringe. Von dort geht es auch auf den Dachboden und in den Keller. Beides nutzen wir derzeit nicht, so viel haben wir nicht aus Wien mitgebracht, wo wir auf 75 m² lebten. Nun dürfen wir uns über 100 m² Wohnfläche freuen, dazu den begrünten Innenhof des Winzerhofes und einen Schuppen sowie einen überdachten Stadel. Vieles erinnert an unser Sommerhäuschen in Finnland – rein atmosphärisch, obwohl eigentlich alles doch ganz anders ist. Will ich zum Supermarkt, der mein Bier verkauft, dann fahre ich knapp sechs Kilometer mit dem Fahrrad, wie in unserem Domizil im Norden. Der Innenhof bietet unseren Jungs wunderbare Bewegungs- und Spielmöglichkeiten, die sie auch reichlich nutzen. Wie im Norden. Und ich habe jede Menge Gelegenheit neben meiner schreibendenTätigkeit am Computer immer wieder einen Abstecher nach draußen zu machen, um mir dieses oder jenes Werkzeug zu besorgen, das nötig ist, um unser Heim innen und außen zu verschönern. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Zudem wird mir der Sommer ein pömpeli bescheren, in dem Mann sich verwirklichen bzw. zurückziehen kann. Es existiert ja schon in Speis und Abstellraum, ist aber noch nicht wirklich eingerichtet und im Winter einfach zu kalt. Was mich auf einen großen Mangel unserer neuen Bleibe bringt: es fehlt die Sauna. Auch sie hat schon ihren Platz in unserer Fantasie, es gilt auch hier den Sommer zu nützen, um Nägel mit Köpfen zu machen. Was aber noch früher geschehen wird, ist das Anschließen unseres CELUS-Küchenofens, der schon seit Mitte Dezember in unserer Wohnküche steht. Er braucht noch die eine oder andere Kleinigkeit und vor allem den strengen Blick des Rauchfangkehrers, den ich ein wenig fürchte und der noch verhindern kann, was ich so wünsche: Feuer, das uns wärmt und unsere Koch- und Backkünste herausfordert – wie in Finnland. Nun bin ich also wirklich zum Reisenden geworden. An zwei bis drei Tagen in der Woche sitze ich in den Zügen zwischen meinem neuen Domizil und Wien, mal über St. Pölten, mal über Hadersdorf am Kamp und immer wieder auch im Anschluss an eine kleine Radtour nach Krems.
Schienenbusse, Doppelstockzüge, aber auch Cityjets und Railjets sind meine Gefährten, die mich sicher und meistens auch pünktlich in die Hautstadt bringen, wo ich einigen existenziellen Beschäftigungen nachgehe. Damit lässt sich das neue Landleben finanzieren, das Haus zur Miete, das dies und jenes braucht, das tolle Obst und Gemüse sowie die Eier, der Honig und der Trauben-, der Apfelsaft und der Wein von unseren NachbarInnen – und natürlich alles, was einem das Leben in einer fünfköpfigen Familie noch so abverlangt. Die Zeit, die mir durch die eineinhalb- bis zweistündigen Fahrten geschenkt wird, nutze ich – wenn ich nicht gerade in Begleitung meiner Frau oder der Jungs unterwegs bin – für mich. Ich schreibe (so wie gerade eben), ich schaue (aus dem Fenster oder ins Narrenkastl), lausche dem einen oder anderen Gespräch bzw. Handytelefonat meiner Mitreisenden, ich träume oder gehe in mich. Was er eine oder die andere im Gespräch mit mir über mein Dasein am Land als Belastung sieht, ist für mich eine neue Qualität in meinem Leben, die ich sehr schätze. Ansichtssache eben. Das, was mich – wenn ich zu Stoßzeiten reisen will – stört, ist die Fülle an Menschen, die da in einen solchen Zug gepackt als soziales Aggregat von hier nach da reisen. Wobei reisen möchte ich diese Vorgang gar nicht nennen, ich denke, dieser Begriff fiele auch den anderen Fahrgästen zu dieser Form der meist erzwungenen Fortbewegung nicht ein. Für mich ist es dennoch in jedem Fall eine Reise voller Handlungen: zum einen, weil ich handle, mich als Handelnder erlebe, zum anderen, weil ich in die eine oder andere Handlung beobachte, mich in sie eingebunden fühle und manchmal sogar in sie eingebunden werde. Auf diese Weise bekommt für mich der Begriff des Handlungs-Reisenden eine zusätzliche, so ursprünglich nicht gemeinte Bedeutung. Und Arthur Miller’s Tod eines Handlungsreisenden möchte ich (m)ein Leben als Handlungs-Reisender entgegenhalten. Möge das Leben dem Tod auf diese Weise immer ein Stück voraus sein. Die Anmaßung könnte größer nicht sein. Die einen sprechen den anderen das Leben ab. Sie teilen ein, in jene, die es verdienen zu existieren und in jene, denen dieses Privileg nicht zusteht. Ich schreibe immer gerne im „WIR“, obwohl ich weiß, dass dies auch jene Minderheit von Menschen einbezieht, die mit einem anderen Blick an die Wirklichkeit herangeht. Die mögen sich nicht gemeint, dennoch vielleicht aufgefordert fühlen, ihre Bemühungen für eine bessere Welt weiterzuführen bzw. zu verstärken, Jede/r auf die je eigene Weise im direkten Umfeld. Denn nur im Kleinen mag sich das Große wirklich nachhaltig verändern.
Mich macht die oben beschriebene Ungerechtigkeit äußerst betroffen. Und da brauchen wir gar nicht über die Grenzen unseres Landes hinausschauen, wir müssen nur ernsthaft einen Blick vor die eigene Haustüre werfen. In meiner neuen Nachbarschaft ist kürzlich ein 52-Jähriger verstorben, Man erzählt, er wäre schon länger arbeitslos gewesen und habe zuletzt nicht nur dem Wein sondern auch dem Wodka zugesprochen. Und aus war’s. Ja, auch so kann’s gehen, wie wohl die Fama natürlich das Ihre zu solchen Schicksalen beiträgt. Wunderlich bloß, dass es entweder niemand in dieser dörflichen Gemeinschaft so genau gewusst hat oder so genau wissen wollte. Und hier sind wir bei einer aus meiner Sicht grundlegenden Herausforderung: Wer von uns möchte gerne bevormundet werden? Wer von uns möchte wirklich gerne „vergewohltätigt“ werden (Zitat Bertrand Stern), wer möchte gerne von Almosen leben, die ein existenzielles Menschenrecht im Mistloch der Gnade ersäufen (dieser Vergleich wird Pestalozzi zugeschrieben)? Niemand! Wie schon Erich Fromm in den 60ern des vorigen Jahrhunderts beschrieben hat, sucht jeder psychisch und physisch gesunde Mensch nach Beschäftigung. Diese Beschäftigung wird nicht nur dem eigenen Wohl dienen, sondern auch einen gesellschaftlich relevanten Beitrag leisten. Wir dulden es aber, dass die Beschäftigung der Menschen eingeteilt wird nach existenzsichernden Tätigkeit (durch Erwerbsarbeit) und nach sogenannten ehrenamtlichen Arbeiten, die man zusätzlich zum Wohl der Gesellschaft tun kann. Ein für mich wesentliches Beispiel, um diesen Irrsinn zu zeigen, ist die Begleitung von jungen Menschen im und ins Leben. Wenn ich bereit bin, meinem Nachwuchs als Elternteil beim Heranwachsen selbst an der Seite zu stehen, dann ist finanziell bald Schluss mit lustig. Auch die nach dem Kindergeld gewährte Familienbeihilfe ist ja – trotz einiger minimaler Anpassungen in den letzten Jahren – niemals wirklich valorisiert worden. Viele andere Leistungen der öffentlichen Hand – wie etwa die PolitikerInnengehälter – jedoch schon. Wenn ich aber meine Kinder in die außerhäusliche Betreuung gebe, um einer Erwerbsarbeit nachkommen zu können, dann fließt plötzlich viel Geld in Infrastruktur und Personal. Nun möchte ich hier nicht über die sicherlich wichtige pädagogische Funktion von Menschen außerhalb der Familie diskutieren, sondern diese grundsätzliche Sichtweise in Frage stellen. Denn auch hier maßen WIR uns an, festzulegen, was gut und richtig ist – und wer daher be-lohn-t wird. Dieses himmelschreiende Unrecht ist also keineswegs gottgewollt oder naturgegeben, sondern menschengemacht. Um es kurz zu sagen: Die Not-wendigkeit eines „garantierten Einkommens für alle“ (Erich Fromm) zeigt sich immer deutlicher. Auf diese Weise käme allen Menschen, das ihnen aufgrund ihrer Geburt zustehende Recht zu, bedingungslos existieren zu dürfen. Alles andere aus meiner Sicht zutiefst unmenschlich. Das trifft auch auf die derzeit in unserem Land herrschenden Verhältnisse zu, die durch die neue Regierung nochmals verschärft werden sollen. Möglicherweise bewirken solche Maßnahmen aber genau das, was es schon längst dringend braucht: eine Initialzündung, um diesem Wahnsinn, sich seine Existenz nicht nur verdienen, sondern auch ständig um sie kämpfen zu müssen, endlich ein Ende zu setzen und mit zukunftsträchtigen Konzepten, Mut und Zuversicht das Neue, das wahrhaft Menschliche zu wagen. WIR könnten natürlich, wenn wir schon dabei sind, gleich auch über unser bestehendes Geld- und Wirtschaftssystem hinausdenken, aber das ist eine andere Geschichte … Mehr als jedes andere Jahr fordert mich das neue 2018 heraus, empfinde ich. Da ich das, was da auf mich zukommt nicht als Einzelsituation erlebe, sondern mich in bester Gesellschaft mit Gleichbetroffenen sehe, wünsche ich mir von all jenen, die zur Bewältigung des Ganzen notwendige Solidarität. Gemeinsam können WIR es schaffen – nur gemeinsam.
Das unsägliche Weihnachtsgeschenk einer neuen Bundesregierung haben wir noch vor dem Jahreswechsel erhalten; diese hat uns gleich ein paar schwerverdauliche Packerln unter den Baum gelegt, verwöhnt uns aber gleichzeitig mit ein paar Zuckerln, die uns all das versüßen sollen. Da ist zum einen die weitere Pflege des Feindbilds „MigrantInnen“. Zum anderen möchte man uns mit der Ermöglichung, unsere Freiheit durch den einen oder anderen Tschick zu gewinnen (Erinnern Sie sich noch an den Marlboro-Man oder den Memphis-Flieger?), unsere Gefangenschaft in Sicherheit und Kontrolle lieb zu gewinnen. Weiters sollen wir ja in Zukunft endlich nicht mehr an die öden 130 auf der Autobahn gebunden werden und bei Rot auch schon mal rechts abbiegen können. Schöne, neue Welt. Dem möchte ich so manches entgegenhalten, ohne bloß nur NEIN zu sagen. Denn ein Nein ist keine Perspektive, ihm fehlt jegliche Vision. Also bin ich schon mal gestiefelt und gespornt und mache mich auf die Reise durch das Jahr – mit der herzlichen Einladung an alle ReisegefährtInnen, die mich begleiten wollen:
Abschließend empfehle ich allen zur Immunisierung gegen die Versüßungen des Unerträglichen das wunderbare Buch „Der überaus starke Willibald“ von Willi Fährmann. Wenn der titelgebende Mäuserich am Ende ohne Schwanz dasteht, ist plötzlich alles aus und vorbei. Spät, aber nicht zu spät. Also gehen wir’s gemeinsam an und lassen es erst gar nicht so weit kommen! Es ist immer Zeit, den ersten Schritt zu tun! 2017 nähert sich seinem Ende. Es war ein bewegtes Jahr. Ein Jahr in dem das Schreiben - trotz immer wiederkehrender Versuche, es am Köcheln zu halten – nur die zweite Geige spielte. Geköchelt hat es trotzdem, bloß in mir. Es ist nicht absehbar, wann die Ergebnisse dieses Köchelns an LeserInnen zum Genießen serviert werden wollen.
Im Vordergrund standen Familiäres & Finanzielles, hier galt es brauchbare Grundlagen zu schaffen, die dem Leben der Familie dienen. Überraschenderweise war es aber auch das Jahr, in dem mehr Veröffentlichungen von mir erschienen, als in den letzten Jahren zusammen. Ganz besonders stolz bin ich auf die Druckausgabe meines Mutmachbuches für Jung und Alt „Olli und der Weihnachtsmann“, das im Oktober das Licht der Welt erblickte. Es ist übrigens kein Buch, das nur zu Weihnachten gelesen und geschenkt werden will, der Weihnachtsmann ist in Finnland ganzjährig am Werken – wie auch Band 2 beweisen wird. Das erste Kapitel dieses weiteren Olli-Buches ist hier nachzulesen. Ebenso wurde mein Beitrag „Wie das Funkhaus mein Leben prägte“ in der Funkhausanthologie der IG Autorinnen Autoren veröffentlicht, des weiteren ein Beitrag über das Freilernen im Buch „Lernen ist wie Atmen“. Über den Sommer entstand das Lehrbuch „Atlas der Kinderbetreuung“, das sich an alle Menschen richtet, die professionell im elementarpädagogischen Bereich tätig sind und ihnen in Kürze das Wesentlichste für ihre wichtige Arbeit mit den jungen Menschen vermittelt. Obwohl ich durchaus zufrieden ob der vielen bewältigten Herausforderungen auf das vergehende Jahr zurückblicken kann, brennt in mir wie immer auch das Feuer der Unruhe, die mich bewegen will, auch dies und jenes zu tun. Da ist es ein Glück – wie Severin Gröbner treffend in seiner Glosse in der Wiener Zeitung anmerkte -, dass es nunmehr den von der neuen Regierung verordneten 12-Stunden-Tag gibt, womit meine Lebenszeit verdoppelt wird und ich in 24 Stunden ganze zwei Tage erleben kann. Was ist das für eine Wohltat für Schaffende meines Kalibers! Dennoch gehen auch solche Jahre regelmäßig zu Ende – so wie eben dieses, das wir 2017 nennen. Das eine geht also, das nächste kommt. Der Mensch neigt dazu, allem einen Namen zu geben, alles in einen Rahmen zu setzen und sich im Namen der Sicherheit so ziemlich allem zu bemächtigen, was existiert. Was einen Namen hat, was einen Rahmen hat, habe ich im Griff, lautet das diesbezügliche Motto. Die Freiheit bleibt bei einem auf diese Weise gelebten Extremismus mehr und mehr auf der Strecke. Der so gepolte Mensch schnürt sich damit selbst von Mal zu Mal mehr ein. Dem gilt es zu begegnen, denn der Mensch ist eine von Geburt durchaus freiheitsliebende Spezies, die dennoch zu jeglicher Kooperation bereit ist. Mal schauen, wie es mir im nächsten Jahr gelingt, mir meine Freiheit zu erhalten und durch mein Tun andere dabei zu begleiten, sich in ihre Freiheit zu begeben – zum eigenen Wohl und zum Wohl der Menschen in ihrer Umgebung. Möge die Übung gelingen! Der Nationalfeiertag hatte für mich selten etwas Feierliches, er war vielmehr wesentlich verknüpft mit dem Militärischen. Als Sohn eines Berufssoldaten wurde ich mit dem Wahnsinn des Bundesheeres, der dort auch in Friedenszeiten herrscht, hautnah konfrontiert. Vor 33 Jahren erlebte ich einen dieser in meinem Leben immer wiederkehrenden höchst ambivalenten Tage. Am 26.Oktober des Jahres 1984, ich hatte im Mai maturiert, leistete ich gerade meinen Militärdienst ab. Um stattdessen den mir eher entsprechenden Zivildienst zu absolvieren, hätte ich mich damals einer Gewissensprüfung vor der Zivildienstkommission stellen müssen. Einerseits überstieg das meine damaligen persönlichen Fähigkeiten, andererseits wollte ich meinen Vater nicht enttäuschen. So begab ich mich in eine achtmonatige Zwangszeit, die mich an den Rand des Nervenzusammenbruchs führte. Davon ahnte ich zwar auch schon am damaligen Nationalfeiertag so einiges, ich hoffte aber, meine in meiner Herkunftsfamilie erworbenen Fähigkeiten des Durchtauchens und Durchhaltens auch hier erfolgreich einsetzen zu können. Also, damals im Jahre 84 stand – ich glaube, es was am Vormittag - meine Angelobung am Programm, irgendwo in Wien-Atzgersdorf auf einem Sportplatz. Ich gelobte im Beisein meiner Eltern und Großeltern. Ob ich meinen Vorsatz, die Formel nicht mitzusprechen bzw. mitzuschreien, damals umsetzte, kann ich heute nicht mehr beschwören. Ich neigte dazu, das Unerträgliche, das Traumatische tief in meinem Inneren zu verstecken, in der Hoffnung, niemand möge es entdecken. Und ich träumte oft vom Möglichen, das mir unmöglich schien. Am Nachmittag jedenfalls kam dann doch so etwas wie Feierstimmung auf, jedoch nicht wegen des Feiertages. Ich hatte mit einem Hörspiel bei einem Literatur-Wettbewerb von Radio Wien den ersten Preis gewonnen und durfte auf der Bühne des Großen Sendesaals im Wiener Funkhaus daraus vorlesen. Gewonnen habe ich damals ein Radio, das am Fahrrad montierbar war und … ich weiß nicht mehr, was noch. Es war jedenfalls ein aufregender Moment, der mich stolz machte. Im Hörspiel ging es um einen jungen Mann, der aus verschmähter Liebe Selbstmord begeht und die Möglichkeit hat, sein Leben aus der Metaperspektive, also von oben, nochmals zu kommentieren. Die Details sind mir nicht mehr so erinnerlich, außer dass ich in dieses Stück alle meine Emotionen und Erfahrungen als junger Mann legte. Irgendwann im Laufe meiner Umzüge ist das Skript verloren gegangen, das Hörspiel wurde nie in voller Länge ausgestrahlt – und meine Suche in den ORF-Archiven war bislang erfolglos, was sie wohl auch bleiben wird. Das war einer dieser frühen Erfolge meiner literarischen Tätigkeit, die ich immer weiter in den Lebenshintergrund drängte, um zu überleben. Heuer, 33 Jahre später, ist die Ambivalenz neuerlich gegeben. Während ich einerseits dem Überleben-Wollen ausgeliefert bin, ist mein erstes Kinderbuch, das vor einigen Jahren entstanden ist, von einem kleinen Schweizer Verlag gedruckt und veröffentlicht worden. Ich durfte das erste druckfrische Exemplar meines Werkes am vergangenen Mittwoch aus den Händen der Illustratorin Irmi Studer-Algader entgegennehmen. Dazu machte ich mich mit meinem Sohn auf die Reise von Wien nach Graz und wieder retour. Diese habe ich auf Twitter und Facebook dokumentiert, ebenso gebe ich in der hier folgenden Fotostrecke einen Einblick in diese Road-Story, die gut zu Olli und seiner Fahrt zum Weihnachtsmann passt. Diese Ereignisse versöhnen mich ein wenig mit dem ungeliebten Nationalfeiertag, den ich damit zu meinem persönlichen Literatur-Feiertag mache. Mal sehen, was in den nächsten Jahren noch alles daraus wird. "Olli's" Reise zum Verfasser - die ganze Geschichte Am Montag, 23.10., knapp vor halb sechs am Abend, schreibt mir Irmi Studer-Algader, die Illustratorin meines Kinderbuches "Olli und der Weihnachstmann", dass sie am Mittwoch, 25.10. nach Graz kommt, um einige private Termine zu absolvieren, und das erste druckfrische Exemplar von "Olli" in der Tasche hat. Sie werde es mir dann von dort per Post nach Wien schicken. Zuvor war es schon aus der Schweiz vom Verlag edition mutuelle aus Winterthur zu ihr nach Monfalcone gereist. Ich rufe sie umgehend an und schlage ihr vor, dass wir uns am Mittwoch in Graz treffen. Wir vereinbaren im Lauf des nächsten Tages ein Zusammenkommen um halb drei am Grazer Hauptbahnhof. Am Mittwoch starte ich um 10 Uhr mit meinem Sohn die große Reise, um Olli und den Weihnachtsmann in Graz abzuholen. Wir fahren mit der S-Bahn zum Wiener Hauptbahnhof, dort bummeln wir ein wenig durch die Etagen und den einen oder anderen Shop, bevor wir uns an der Würstelboutique mit zwei Hotdogs laben. Und um 11.58 Uhr geht es mit dem Railjet los in Richtung Graz. Knapp nach halb acht Uhr abends treffen mein Sohn & ich mit Olli und dem Weihnachstmann zuhause ein. Dem Roadtrip der beiden ist damit noch ein Kapitel hinzugefügt worden.
"Olli" ist bereit für weitere Reisen und kann ab sofort beim Verlag erworben werden. Am 4.12.17 reist er auch in den Wiener Bücherschmaus, wo ich ab 19 Uhr lese und signiere. Nach 45 Minuten hab‘ ich die Patsch’n g’streckt, obwohl ich mich ehrlich bemüht habe. Da ich um 15 Uhr zur Liveübertragung der als Duell unter dem Titel „Die großen Drei um drei“ von den österreichischen Bundesländerzeitungen inszenierten Konfrontation zwischen Bundeskanzler Kern, Außenminister Kurz und FPÖ-Chef Strache noch anderes zu tun hatte, zog ich mir die Aufzeichnung erst knapp vor Mitternacht rein. Diese Tatsache aber war nicht der Grund für meine Müdigkeit, weil ich, wenn’s wirklich spannend ist, auch zu so nachtschlafender Stunde hellwach sein kann.
Vielmehr zog sich die „Diskussion“, die mehr einen Aneinanderreihung von Monologen war, wie ein Kaugummi. Da wurde Altbekanntes als die Lösung des Problems (z.B. Bildungspflicht) verkauft, da wurden Rezepte geboten, die keinerlei Linderung der offenen Wunden unserer Gesellschaft bringen werden (z. B. Deutsch vor Schule). Da wurde die eine oder andere Wuchtel geschoben (z. B. Strache zu Kurz: „Ich freu mich, dass Sie ein Fan von mir sind!“). Und genau das war so ermüdend. Der eine hatte die Weisheit mit dem Löffel gefressen (Kurz), der andere versuchte verzweifelt zu zeigen, dass alle Ideen eigentlich von ihm stammen (Strache), der dritte gab den coolen „Papa“ (seiner aufgekratzten „Söhne“), der’s schon richten wird, wenn man ihn bloß weiter ließe (Kern). Der Succus der danach befragten Chefredakteure der Bundesländerzeitungen, den ich mir nach Abbruch des Duell-Schauens noch schnell vor dem Zu-Bett-Gehen zu Gemüte führte, brachte das erwartbare Ergebnis: alle waren der Ansicht, dass wir wohl auf die nächste blau-schwarze Regierung zusteuern würden und Verteidigungsminister Doskozil die SPÖ in der Opposition anführen werde. Für meine derart negative Bewertung der drei Männer am Schmäh ist wohl auch die Sendung „erlesen“ verantwortlich, die ich mir kurz vorher zum Ausklang des von mir mit dem 3. Nie-mehr-Schule-Aktionstag begangenen Internationalen Tag der Bildungsfreiheit in der ORF-TV-Thek gemeinsam mit meiner Frau angeschaut habe. Da führte Konrad Paul Liessmann den für die Schulen verantwortlichen PolitikerInnen vor Augen, dass sie unter dem Motto „Beste Bildung für alle“ wohl eher der Vermittlung von Unbildung frönten, um an der Macht zu bleiben. Mehr Kontrast geht nicht. Aber machen Sie sich selbst ein Bild. Ich möchte ich den drei Schmähbrüdern, die unser Land in der Hand haben(wollen) abschließend noch eine Erkenntnis Albert Einsteins um die Ohren hauen: „No problem can be solved from the same level of consciousness that created it.“ Aber so viel Bildung ist wohl (und da bin ich ganz bei Liessmann) brandgefährlich – vor allem für die drei und ihren Machtanspruch. Da bilden wir doch lieber alle aus und halten sie (für) dumm. Gestern also war es soweit. Die Straßenbahnlinie, die mich seit meiner Kindheit begleitet hat, stellte ihren Betrieb ein. Laut Sonderfahrplan fuhr die letzte Blaue sogar erst heute um 0.34 Uhr vom Westbahnhof nach Unter St. Veit. Mit Betriebsbeginn ist ab dem heutigen Tag zwischen Westbahnhof und Hietzing dann der 60er unterwegs, den Streckenteil von Hietzing nach Unter St. Veit übernimmt der 10er.
Unser Jüngster und ich haben den Abschied vom 58er ausgiebig zelebriert. Glücklicherweise haben die Wiener Linien einen zuerst als Geheimtipp gehandelten Abschlussnachmittag doch noch im Internet veröffentlicht und einer Straßenbahnlinie, die mehr als 100 Jahre im Wiener Öffi-Netz aktiv war, einen gebührenden Abschied ermöglicht. Mein Sohn und ich starteten also um 16.36 in der Hummelgasse mit einer besonderen Wagenkombination aus Triebwagen 2 und Beiwagen 3442. Der 2er ist immerhin seit 1944 auf Schiene, hat die völlig vergessene Bim-Farbe beige und sieht auch sonst so ganz besonders aus. Danach wechselten wir am Westbahnhof in die Kombi aus Triebwagen 1 und Beiwagen 5210 und fuhren retour. Und weil wir dann immer noch nicht genug hatten, fuhren wir noch einmal, diesmal mit einem altbekannten Gespann aus Triebwagen E1 und Beiwagen C3 zurück zum Westbahnhof, das unser Jüngster schon aus den Zeiten im Kindergarten gut kennt, weil wir damit auf der Linie 5 allmorgendlich zu seiner Bildungsstätte gondelten. Einmal hat ihn eine Fahrerin sogar dazu eingeladen, die Klingel zu betätigen und ihm dann auch noch dies und das erklärt. Meistens aber saßen wir entweder still auf der Dreierbank direkt hinter den FahrerInnen oder wir nahmen im Beiwagen auf den beiden Sitzen gleich im vordersten Bereich Platz, auf denen man den besonderen Blick nach drau0en hat und sich wie die FahrerInnen selbst fühlen kann. Von Zeit zu Zeit war es uns sogar vergönnt, dass wir den C3 mit Holzboden erreichten, der diesen für mich so heimeligen und angenehmen Geruch ausstrahlt. Mit ihm aber – so habe ich gehört – soll es amit heutigem Tag ebenfalls vorbei sein. Zurück zum 58er. Der ist in meiner Erinnerung auch als jene Linie verankert, die mein Vater, der in Kriegs- und Nachkriegszeiten im 15. Bezirk aufgewachsen ist, sehr gut kannte; so gut, dass er auch noch mehr als 30 Jahre später – als wir auf unseren Wanderungen hie und da Straßenbahn spielten – die Haltestellen auswendig aufsagen konnte. Dabei hielt ich seinen rechten Arm, der den „Gashebel“ darstellte. Je mehr ich ihn nach oben drückte, desto schneller ging er. Wenn ich seinen Handrücken drückte, machte er die Ansage der nächsten Station. Auch ich bin in meiner Kindheit, deren erste Jahre ich in Penzing nahe der Kennedybrücke erlebt habe, oft von Hietzing auf die Mariahilferstraße zum Einkaufen gefahren. Damals gab es ja noch keine U-Bahn und die Bim tuckerte vom Westbahnhof die gesamte innere Mariahilferstraße bis zum Burgring entlang. Später dann, als ich bei meiner ersten Freundin nahe dem Schwendermarkt wohnte, brachten er und sein Kollege, der 52er, mich nach Schönbrunn zum Jogging. Und in den letzten Wochen und Monaten gab es nach langer Abstinenz wieder die eine oder andere Fahrt, wenn ich mal „unberadelt“ und zum Gehen zu bequem den Umweg von zuhause über Hietzing nahm, um an eine meiner Wirkungsstätten zu gelangen. Die 58er-Strecke bleibt zwar erhalten, der 58er selbst aber ist Geschichte, so wie mein Vater und die vielen Ereignisse, die mich mit ihm verbinden. Auf ein Neues! |
Hinweis:
Meine Meinung zu aktuellen Themen habe ich bis 1.9.2015 im Blog "Mein Senf zu allem" veröffentlicht. Seither habe ich sie auf dieser Seite in meine Tagebucheinträge integriert.
Archiv
Juli 2019
|
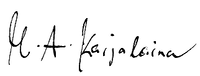











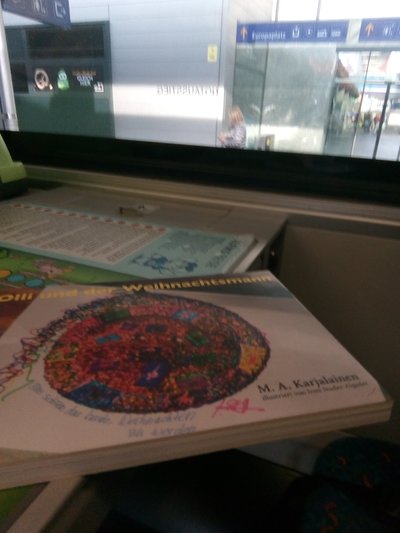
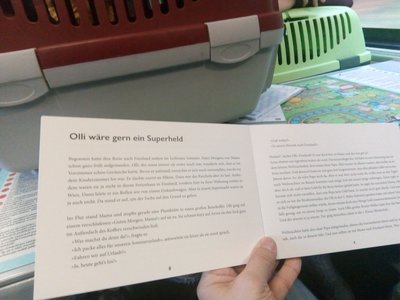

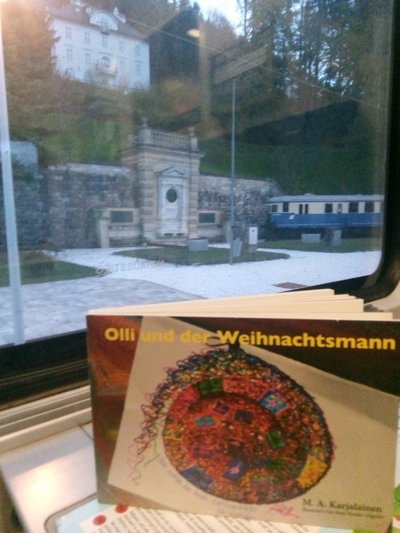


 RSS-Feed
RSS-Feed
