dem Wiener Bücherschmaus zum 1. Geburtstag gewidmet Ich kenne da einen Laden an einer Dreistraßenecke mitten im dichten Dickicht der großen Stadt, den keiner unverändert verlässt. Auch die, die meinen nichts abbekommen zu haben, werden sich einige Zeit später bewusst, dass sich ihr Leben gewandelt hat.
Die meisten bringen etwas, was sie loswerden wollen und hoffen damit eine gute Tat begangen zu haben, weil sie das Gebrachte nicht vorher schon weggeworfen haben und es auf diese Weise etwas Neues stiften könne: Freude oder Bildung oder Kompetenz oder „Ja-was-weiß-man-schon“. Nicht alles aber wird von den beiden Betreibern angenommen, weil es sonst nur in anderen Regalen verstauben würde als bisher. Da sind sie ganz streng die beiden, aber mit milden Worten. Er, der Betreiber, bildet dann Sätze, die sich in mehreren Windungen ohrwärts räkeln und meist dazu führen, dass man den Laden zwar unverrichteter Dinge aber mit guter Laune verlässt, immer um ein Lesezeichen oder einen guten Tipp reicher. So beginnt der Wandel. Sie, die Betreiberin, ist da von direkterer Art, aber keineswegs unfreundlich. Vielmehr verursacht ihr herber Blick über die Brillenränder ein Schmunzeln, mal auf den Lippen, mal nur im Inneren. Auch so fängt der Wandel an. Und wenn einmal die Hündin der beiden da ist, die auf den Namen eines herbstlich reifenden Steinobstes und einer griechischen Hafenstadt hört, dann bleibt ohnehin kein Herz unberührt und es fallen Worte, die sonst nicht gewechselt worden wären. Die, die nichts bringen, kommen dennoch, um etwas los zu werden: einen Wunsch, eine Qual, die schwer auf der Seele lastet oder auch ein Bedürfnis, mal ganz nah versorgt zu werden. Und das werden sie: mit einem feinen Ratschlag oder einem der besten türkischen Kaffees der Stadt, die der Meister des Hauses auf einer kleinen elektrischen Kochplatte ganz persönlich und in immer dem gleichen, genau festgelegten Ritual zubereitet oder gar mit dem Stoff, aus dem Lebensträume sind. Schon von außen spricht der Laden die Vorübergehenden an, jeder fühlt sich persönlich gemeint, manche aber ergreifen sobald sie die liebevoll gestalteten Auslagen sehen, sofort die Flucht, da sie das aus dem Alltag-Fallen fürchten, das auch ihr Leben verändern könnte. Jedes Kind mag hinein, nicht alle Eltern. Hinter den Schaufensterscheiben wimmelt es je nach aktuellem Angebot von unsäglich Selbstgemachtem (man erkennt unschwer, dass die Betreiberin hier höchst selbst Hand angelegt hat), auch vor der Eingangstür des Ladens lädt ein Tischchen mit zwei Stühlen zum Verweilen unter einer groß aufgeblasenen Sonnenblume ein, die – um vom Wind nicht verweht zu werden – fürsorglich an einer Schnur festgebunden ist. Die Liebe, nein die Passion der beiden Besitzer, spricht hier aus jedem Detail. Wer diesen Ort noch nicht kennt, hat mindestens etwas versäumt, wenn nicht sogar alles. Wer diesen einmaligen Raum, dieses lauschige Plätzchen nun stante pede kennen lernen möchte, um sich am Genuss seiner Waren zu laben, muss nur seinem Gusto auf Bücher folgen – und schon wird er fündig werden, in jenem kleinen Laden an der Dreistraßenecke mitten im Dickicht der großen Stadt. Und er darf voller Zuversicht sein, dass er auf solche Weise gewandelt auf noch besseren Spuren seines Lebens wandeln wird, wenn er einmal durch das Portal eingetreten ist, in jene Stätte, deren Wandregale voll sind mit allem, was man vom Leben erwarten darf.
0 Comments
für Irmi, zu einem besonderen Geburtstag Die Katze im Nachmittagssonnenschein. Stoisch. Die Augen zu engen Schlitzen geformt. Viel Weiß. Ein wenig Schwarz von den Wangen aufwärts bis zu den Ohren. Ein kleiner rot-brauner Fleck an der linken Schulter. Die Vorderpfoten ruhen im Habt-Acht auf bereits mattem Terrazzo. Sprengsel von grau, rot-braun und weiß, auch ein wenig schwarz. Nach dem Mahl ist vor dem Mahl. Die Ruhe vor dem nächsten Sprung. Eine Ruhe die das Herz berührt, das sogleich gelassener schlägt. Lassen. Einlassen auf das Jetzt. Lassen und tun, Nur tun, was nicht gelassen werden will. Abbild eines nie endenden Augenblicks.
Miri dreht das Foto, stellt es auf den Kopf, entdeckt das Gelb im Hintergrund, verschwommen. Die Frucht eines Zitronenbäumchens auf jener Terrasse wird selbst zur Sonne, von der sie ihre Farbe bekommen hat. Dieser Ausschnitt wird zu einem neuen Bild, das von der Kraft des Lebens erzählt. Eine Drehung um 45 Grad verstärkt dessen Ausdruck. Malerisch. Aufgetragen auf eine Leinwand, 40 mal 60, nein, besser im Quadrat 50 mal 50. Die Augen ruhen nie. Ein Eindruck jagt den nächsten, jeder verlangt nach Ausdruck. Der Hafen. Ein Mosaik bunter Teilchen. Rechts der schwarz-rote Trawler. Darüber wolkenloser Himmel in Azur, darunter kaum bewegtes Meer in Grau-Blau. Im Hintergrund die Häuser der Hafenstadt, die tief hinein in die sanften Hügel reichen und den Horizont berühren. Ausgestreckt über allem die Krakenarme der Ladekräne. Sie ragen ins Leer und fassen nichts. Kein Mensch zu sehen, doch alles voll Leben. Lässt du dich darauf ein, wirst du Teil des Geschehens, bist beteiligt, Aktionär dieses Daseins, das dein Dasein werden will. Oft schon bist du zwischen diesen Häusern geschlendert, hügelauf- und hügelabwärts. Viele Male schon haben deine Schritte den grauen Asphalt des Kais berührt, manchmal aufgeregt laufend, manchmal nachdenklich schreitend, meist deiner unbewusst. Einige Male waren deine Schritte nicht allein, wurden von anderen Schritten begleitet, von Zeit zu Zeit sogar im Gleichklang. Nur wer ganz genau schaut, findet all das und noch mehr in diesem Bild jenes Hafens. Auch deine Sehnsucht liegt im Blau, die Sehnsucht beim Blick von dort auf’s offene Meer hinaus. Das Leben muss dort sein, obwohl es doch hier ist. Welches Leben? Wessen Leben? Führen und Führen-Lassen. Welches und wessen ist es, das du führst? Draußen ist Freiheit, dort wo der Horizont beginnt. Kannst du den jemals erreichen? Willst du ihn jemals erreichen? Macht dich nicht genau dieses Sehnen lebendig und stürbest du nicht deiner Täuschung, wenn du jemals an diese Linie kämst? Deadline ... Miri’s Blick verliert sich da und dort und dort und da, doch verliert sie sich nie. Selten. Der Augenblick ist ihr Metier. Sie hält ihn fest. Nicht das Davor und Danach. Und doch erzählt sie mehr noch genau davon. Sie weiß nichts, doch ahnt sie. Das ist die Kraft ihrer Bilder. Aussagekraft. Mit Leichtigkeit wählt sie den Ausschnitt. Einschnitt ins Leben. Zuschnitt. Goldener Schnitt eines Momentums, dem sie mit einem Klick seine Eindeutigkeit und die vielen Bedeutungen schenkt. Wäre er nicht vor ihre Kamera gelaufen, dieses Porträt hätte niemals das Licht der Welt erblickt. Die rote Blüte des Klatschmohns, getragen von einem mehrmals verschlungenen zierlichen Stängel, verwurzelt in der Mauerritze des Steinhauses am Ende der Gasse. Ein zarter Sonnenstrahl, die perfekte Sekunde. Plötzlich Schatten. Sein Schatten und sein “Scusi, Signorina!”, die beschwichtigenden Handbewegungen und ihr ärgerlicher Blick aus der Hocke hoch zu ihm, in seine blitzblauen Augen. “Wie kann ich das wieder gut machen?” “Gar nicht. Ein Augenblick ist ein Augenblick. Ist er vorbei, ist er vorbei!” Und doch wurde jenes Porträt geboren. Eine Stunde im Cafe auf der Piazza komprimiert auf diesen einen Moment. Davor: seine wortreichen Entschuldigungen und die oft wiederholten Einladungen, bis sie schließlich annahm; ihre Körper warfen lange Schatten auf die nachmittagssonnendurchflutete steingepflasterte Gasse vor ihnen; ihre Schritte hetzten den Schatten nach ohne jede Chance, diese jemals einholen zu können; die ihren eilten voraus als wollten sie fliehen, seine hinterher als liefe er um sein Leben; der Platz nahe am Sonnenuntergang; zwei weiße Stühle, ein weißer Tisch, ein kleines weißes Schildchen auf weißlackiertem hölzernen Fuß, eine knallrote Neun; sein Ristretto, ihr Macchiato; viele Worte, wenig Aussage; doch ihre Leidenschaft siegte und versuchte ihn festzuhalten; zufrieden war sie erst beim siebenten Anlauf. Andrea und Miri. Er lächelt. Sie lächelt. Sie lächeln. Er: Kurzes, schwarzes, nach hinten gegeltes Haar, diese hellblauen Augen, gebräunter Teint, hinter den vollen Lippen blitzen weiße Zähne hervor. Sie: Rotbraune Locken, wild und ungekämmt, die dunklen Augen direkt ins Objektiv gerichtet, blasse Wangen und tiefrote Lippen, die schmunzeln. Der Kragen seines weit aufgeknöpften weißen Hemdes, ihre Korallenkette und die Träger des rostroten Sommerkleides auf den hellen, schmalen Schultern. Die beiden: ganz nahe, fast cheek-to-cheek, weil alles am Selfie Platz haben soll; über ihnen die Reste des Tages im bereits dämmrigen Blau. Danach: ihr Abschiedskuss auf seine Lippen gehaucht; seine Hand, die ihre nicht lassen will; ihr Entwinden; ein letzter Blick aus der schnell entstandenen Fremde; seine Kusshand aus der Ferne des hinter ihm untergehenden Tages; die Stille und kein Zufall. Was bleibt, stiften die Liebenden. Das gerahmte Porträt auf Leinwand, 60 mal 40, als einer von vielen Augenblicken, die ihre ewige Gegenwart fristen an jener fotobedeckten, malerischen, kaum noch sichtbaren Wand im Wohnzimmer von Miris Häuschen am Rande der Stadt, nächst des Ufers der nördlichen Adria. Doch: Der nächste Moment wartet schon Ewigkeiten, um von Miri für immer auf ein weiteres ihrer Fotos gemalt zu werden. Textauszug aus meinem Plädoyer für das Leben ... Der Morgen dämmert. Und auch ich dämmere seit Stunden vor mich hin. Mich schmerzen alle Glieder. Die Lider sind bleischwer. Ich will meine Augen nicht mehr öffnen und diese sterbende Welt um mich herum betrachten. Genug gesehen. Schon lange, lange her, dass ich mit der angeborenen Neugier dieses Kindes, das ich einmal war, durch dieses Leben gerannt bin, jeden Tag voll neuer Ideen und mit dem Enthusiasmus des Weltmeerseglers begonnen habe und mich Wind und Wetter trotzend auf das Sein eingelassen habe. Nun besteht mein Leben aus dem Bedauern des Vergangenen und aus der Furcht vor der Zukunft. Ich habe es verloren, ich habe mich verloren, gefangen in den Bildern meiner Seele und der von ihnen in diese Welt projizierten Kopien. Irgendwie habe ich es in dieser letzten Stunde dann doch geschafft, mich hier in dieses Cafe zu retten. Bewegung statt Stillstand, Lachen, Leben … das Paradoxon eines Alltags in dieser Welt der sich selbst Entfremdeten, der Untertanen, der Bedrohten, der Entmutigten und Entsolidarisierten. Die Zigarette schmeckt nicht und schon gar nicht der Kaffee. Auf mein Frühstückskipferl verzichte ich heroisch und begebe mich zurück in das Gefängnis meiner Gedanken. Da steht plötzlich sie vor mir, den „Augustin“ in der Hand. …oh du lieber Augustin, alles ist hin … Wie recht er doch hatte. Und doch: die Legende sagt etwas anderes. Da fällt einer in die Pestgrube und geht unbeschadet daraus hervor. Unbelieveable. „Darf ich mich setzen, Meister?“ Ich mache eine undeutliche Handbewegung, die sie als Einladung versteht. „Na, lange Nacht gehabt?“ Was soll denn das jetzt werden? Nach Reden ist mir jetzt aber wirklich nicht zu Mute. Diesen Mut habe ich längst verloren, Redenschwingender, der ich in meiner Jugend war. Da war ich überall zu finden, wo es sich politisch zu engagieren gab. Damals träumte ich von weißen Pferden …wilden weißen Pferden an einem Strand, mein Lehrer war ein Vogel und brachte mir das Fliegen bei … aber sag mir woran, woran meine Liebe glauben wir noch … Ja woran, woran glaube ich heute noch? Ich nestle eine nächste Zigarette aus der vor mir liegenden Packung. „Darf ich?“ Automatisch strecke ich ihr die Zigarettenpackung hin, sie greift sich gleich drei. „Feuer?“ Ich zünde automatisch zuerst ihre, dann meine an. Sie facht nach dem ersten Zug mit dem Ausatmen die Glut ihrer Zigarettenspitze an. Dann lehnt sie ihr Kinn auf den Ballen der Hand, in der sie die Zigarette hält und stützt den Ellbogen auf den Tisch. Sie schaut mich an. Ich lehne mich zurück. Die Rückenlehne der gepolsterten Bank, die auch schon bessere Zeiten gesehen hat, knarrt gefährlich. Ich blicke den Rauchschwaden nach, ziehe an der Kippe und blicke wieder den Rauchschwaden nach. „Darf ich?“ Ohne meine Antwort abzuwarten hat sie sich das unberührte Kipferl gegriffen und teilt es in der Mitte. Die Zigaretten hat sie dabei nicht aus den Fingern gelassen. Nun nimmt sie einen Bissen, dann einen Zug. So geht das einige Male bis das Kipferl weg ist und der Tschick ausgeraucht. „Magst was trinken?“ Das sind die ersten Worte, die ich an sie richte. Da sie zögert, ergänze ich: „Auf meine Kosten!“ Sie bestellt einen English Breakfast und einen doppelten Kognak. Sie greift nach meinem Zigarettenpackerl und dem Feuerzeug und raucht die nächste. Ich starre widerstandslos vor mich hin. „Augustin?“ Ich lege ihr wie ferngesteuert drei Euro hin. „Das Blatt’l kannst du dir behalten“ Sie schiebt die drei Euro zu mir zurück. „Osho?“ Verblüfft verschlägt es mir die letzten Worte, während sie ein abgegriffenes Taschenbuch aus der Jackentasche zieht. Ich muss es auch klar machen, dass die Politik nur die mittelmäßigsten Geister der Menschheit anzieht. Sie zieht nicht Menschen wie Albert Einstein, Jean Paul Sartre, Rabindranath Tagore an … Nein, sie zieht nur bestimmte Menschen an. Psychologen wissen, dass Menschen mit einem Minderwertigkeitskomplex sich zur Politik hingezogen fühlen, denn Politik kann ihnen Macht verleihen. Und mit dieser Macht können sie sich und andere davon überzeugen, dass sie nicht minderwertig sind, dass sie nicht mittelmäßig sind. Aber die Macht verändert ihre Intelligenz nicht. Die ganze Welt wird also von mittelmäßigen Geistern regiert, während wir doch viele intelligente Menschen haben – Wissenschaftler, Künstler, Musiker, Poeten, Tänzer, Maler – viele sensible, kreative Menschen, die Creme der Menschheit, aber sie haben keine Macht. Sie könnten den Lauf der menschlichen Geschichte ändern, sie könnten das Dunkel der Zukunft in einen wunderschönen Morgen verwandeln, in einen Sonnenaufgang. … Sonnenaufgang hallt es noch in ihr Schweigen hinein nach. … „Osho hat recht!“ „Osho hat doch immer recht, vor allem wenn man eine seiner verqueren Anhängerinnen ist!“ „Nö, immer hat er nicht recht. Mit seinem Lebensstil, seinem Rolls Royce, seinem Abhängigmachen anderer, mit seinem Tod … da hat er absolut nicht recht. Aber an dem, was ich dir vorgelesen habe, da stimmt so ziemlich alles.“ „Meinste …“ „Mein ich nicht nur, weiß ich!“ Die Kellnerin kommt mit der Rechnung. Ich bestelle noch ein kleines Bier und verschiebe das Zahlen auf später. „Und woher weißt du das jetzt so genau?“ „Ich war eine der seinen“ „Echt jetzt?“ „Ja, drei Jahre lang. Drei lange Jahre lang. Dann hatte ich endgültig alles verloren und mich immer noch nicht gefunden.“ Pause. Ich halte ihr meine Zigarettenpackung hin, sie bedient sich. Dann ich. Ich zünde zuerst ihre an, dann meine. „Seit wann lebst du jetzt schon auf der Straße? Wann ist der große Meister denn verblichen?“ „Ich lebe nicht mehr auf der Straße. Sonst hätte ich kein Bett, in dem ich aufwachen kann, keinen Spiegel in dem ich mir in die Augen schauen kann und keine drei Kleider aus denen ich wählen kann.“ „Wieso, ein Bahnhofsklo tut’s doch auch …“ „Du verstehst gar nichts. Klischees, alles Klischees, Stereotype …“ „Wo hast du denn diesen Wortschatz her?“ „Matura. Studium der Psychologie und Philosophie.“ „Echt jetzt?“ „Why not?“ „Na ja, wenn man so aufgeklärt ist, dann sollte man doch so einem wie Osho nicht in die Fänge geraten …“ „Why not?“ „ Was jetzt?“ „ Gerade dann ist die Gefahr groß, einem wie Osho auf den Leim zu gehen …“ … „Und du, wem bist du auf den Leim gegangen?“ „Den Linken … und ihrer Parole von der Gleichheit aller Menschen. But: … All animals are equal but some are more equal than others. “ “Was hast du gelernt?” “Publizistik und Politikwissenschaft” „Wow. Und trotzdem auch nicht g’scheiter g’scheitert?“ „Wieso gescheitert?“ „Oh, verzeih’, ich dachte du bist in einer Sinnkrise, so wie du dasitzt, nicht rasiert und in den Klamotten vom Vortag.“ „Also bitte …“ „Mir musst du nichts vormachen. Und schon gar nicht dir selbst.“ „Ich mach weder dir noch mir was vor …“ „Achso. Dann habe ich also Tomaten auf den Augen.“ … Sie springt auf, packt ihre Tasche und geht schnellen Schrittes Richtung Ausgang. Ich wiesle hinter ihr her, krieg sie noch vor der Tür zu fassen und bitte sie um Verzeihung. „Bestell dir noch was. Und lass uns einfach weiter reden.“ Ich kann sie umstimmen und gemeinsam kehren wir an unseren Platz zurück. Ein Platz an dem ein Hauch von Frühling spürbar wird, the wind of change die verrauchte Luft erfüllt. Sie braucht noch eine Weile bis sie mir wieder traut. Ich sage nichts. Ich rauche. Sie kippt ihren doppelten Kognak. Dann lacht sie. „Enttäuschte dieser Erde, vereinigt euch!“ Sie beginnt die Internationale vor sich hin zu summen und lächelt mich dabei weiter an. Ich stimme ein. Beim Refrain ist aus dem Summen ein lauter Gesang geworden. Völker, hört die Signale! Auf zum letzten Gefecht! Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Die Wiederholung des Refrains geht dann schon in unserem schallenden Gelächter unter. Von einigen Tischen bekommen wir sogar Applaus. Kurze Zeit später läuft wieder alles wieder in seinen gewohnten Bahnen. Weder die Internationale noch unsere Interpretation konnten die Welt verändern. … Der ganze Text kann als E-Book (43 Seiten) um € 5,- oder in einer Druckversion um
€ 7,- erworben werden. Darüber hinausgehende Beträge gehen an den Wiener Bücherschmaus zur Leseförderung für Kinder und Jugendliche! K.H. Gessler, eigentlich Konrad Heinrich Gessler, war das ganz große Los, das Donner vor kurzem gezogen hatte. Wie der auf ihn gekommen war, wusste er nicht so wirklich, es gab die Version des Betroffenen, dann jene seines Pressesprechers und schließlich die, die sich Peter zusammengereimt hatte.
Also, dieser Gessler war vor längerem, sprich etwa vor 6 Monaten zum neuen Innenminister der Republik angelobt worden. In seinem früheren Leben war er der Eigentümer einer Sicherheitsfirma, die im Auftrag der Regierung die Erneuerung und Verwaltung des einzigen Erstaufnahmezentrums für Flüchtlinge im Osten des Landes übernommen hatte. Dieses hatte er nach den gravierenden Mängeln, die in der Verwaltung des Bundes aufgetreten waren, um eine knappe Million Euro auf Vordermann gebracht. Aufgrund des sparsamsten Einsatzes von Mitteln für die Renovierung des Gebäudes und die Adaptierung der Unterkünfte, hatte er bei dieser Einmalinvestition rund die Hälfte des Betrages als Gewinn verbuchen können, was vertraglich auch so vereinbart war. Auch bei den laufenden Kosten für den Betrieb sowie der Bezahlung der Sicherheitskräfte konnte er regelmäßig Gewinne erzielen, so dass er sich ein schönes Sparkonto angehäuft hatte. Sowohl die Regierung als auch die unmittelbar betroffene Bevölkerung jenes kleinen Ortes knapp südlich der Hauptstadt waren darob äußerst zufrieden mit ihm. Deswegen und aufgrund seiner ausgezeichneten Kontakte zur Regierungsspitze empfahl er sich für die Übernahme des Innenressorts, das auch für die Flüchtlinge zuständig war. Seine Vorgängerin hatte aufgrund einer - wie man von Regierungsseite betonte - unglücklichen Aussage über die Asylwerber und unter dem daraufhin folgenden Druck der Medien, der Opposition und der verantwortlichen EU-Kommissarin zurücktreten müssen. Zudem wollte der Herr Vizekanzler, der aus patriachaler Familie stammte, endlich wieder einen Mann an dieser Stelle haben, womit er sich bei der letzten Regierungsbildung allerdings nicht durchgesetzt hatte, was er aber nun schließlich, nicht ohne ein süffisantes Lächeln zu zeigen, nachholte. Gessler war noch dazu kein parteigebundenes Urgestein, er galt als parteifrei, doch dem Recht und der Ordnung nahestehend, also doch quasi parteinah. Die Partei gleichen Namens war erst vor zwei Jahren Teil der aktuellen politischen Obrigkeit geworden, hatte sich als fast gleichstarke Gruppierung mit den nur knapp stärkeren Sozialen - dereinst links, dann links der Mitte und dann plötzlich über Nacht rechts davon, wiewohl per Eigendefiniton höchstens Mitte - ins Bett gelegt und wurde vom Boulevard gerne als Rechts-Soziale Bundesregierung bezeichnet. Manche meinten, sozial-rechts würde es deutlicher sagen, einige wenige gingen sogar soweit, den Regierenden das sozial überhaupt abzusprechen, außer wenn es um die eigenen Taschen ging. K.H. Gessler, kurz KHG genannt, war der charmanteste Innenminister, den die Republik je gesehen hatte. Zudem galt er in gewissen Frauenkreisen als Beau - andere Frauenkreise aber fanden ganz andere, ja gegenteilige Namen. Ebenso galt er als Liebling des Boulevard. Gleich nach seinem Amtsantritt war in mehreren Medien des bedeutendsten Medienkonzerns des Landes eine Homestory erschienen, in der auch seine Verlobte Farina, die Erbin eines großen Stahlprodukte-Herstellers, eine bedeutende Rolle spielte. Auch das Penthouse in bester Zentrumslage der Hauptstadt mit weitem Blick nach allen Himmelsrichtungen wurde ins beste Licht gerückt. Der Mann hatte also Weitblick und Überblick, was ihm als Sicherheitsminister des Landes jedenfalls entgegenkam. Kurz nach Veröffentlichung der Homestory tauchten in einem Internetblog der extremen Linken böse Gerüchte über die angebliche Bisexualität Gesslers auf, deren Verfasser sofort nach Veröffentlichung Besuch von der Exekutive erhalten hatte. Dabei wurden, was keiner wusste, sämtliche elektronische Geräte, unter anderem auch der Radiowecker und der Trockenrasierer des Betroffenen beschlagnahmt und zur kriminaltechnischen Untersuchung zur KTU gebracht. Der Verfasser wurde trotz Protesten seines Anwalts für 48 Stunden in Gewahrsam genommen, seither, obwohl das nun schon mehrere Wochen her war, wurde nichts mehr über ihn bekannt. Diese Gerüchte waren auch der Grund gewesen, warum KHG einen persönlichen Berater engagieren wollte. Sein Pressesprecher war anfangs schwer dagegen gewesen. Es war aus seiner Sicht viel zu auffällig gewesen, jemanden weiteren einzuweihen, wenn sich doch die Aussagen als bodenlos herausgestellt hatten und der Verursacher längst dingfest gemacht worden war. Gessler aber beharrte darauf, er wolle sich nicht ständig von irgendeinem Presse-Fuzzi PR-technisch das Hirn vollwichsen lassen – wie er wörtlich betont hatte - sondern mal mit jemandem reden, der vom richtigen Leben eine Ahnung hatte. Wie er dann gerade auf Peter Donner gekommen war, das war eine weitere jener verworrenen Geschichten, die Donners Leben so gerne schrieb. Also: Farina Maria Ceccarelli, KHGs Verlobte hatte eine Friseurin, der sie sich gerne anvertraute; so sparte sie Therapiekosten und zudem brachte das jedesmal was für die „Fassade“. So hatte ihr Papa, der in seinem Heimatland viel verehrte und gefürchtete Zampano Mario Ceccarelli, seines Zeichens CEO des von seinem Urgroßvater gegründeten Stahlproduzenten Ceccarelli und Söhne, immer zu ihr gesagt, wenn sie im elterlichen Badezimmer stundenlang an ihrem Makeup gefeilt hatte. Ihres Papas Firma war in Zeiten, da sich Europa gegen die Flüchtlingsströme abschirmen musste, um seine Identität nicht zu verlieren, wie der derzeitige EU-Vorsitzende Pitti, ein Landsmann der Ceccarellis, nicht müde wurde zu betonen, groß mit der Herstellung und dem Vertrieb von NATO-Draht für Grenzzäune im Geschäft. Farina also nahm die kostenlose Beratung ihrer Friseuse in Anspruch, zumal sie Seelenklemptner ums Verrecken nicht ausstehen konnte. Von Zeit zu Zeit musste sie einfach mal Dampf ablassen, manchmal einmal die Woche, manchmal, jedoch viel seltener, auch nur einmal im Monat. Diese Friseurin, die auf den Namen Monika getauft worden war aber nur auf dessen etwas kuriose Kurzform Ika hörte, erfuhr von Farina, die von ihren engsten Vertrauten Rinni gerufen wurde, was Ika nicht wusste und auch nicht wissen sollte, sie daher Signorina Ceccarelli nannte, sie erfuhr also, dass Rinnis Zukünftiger jetzt auf den Seelenhund gekommen war und dringend professionelle Beratung brauchte. Beim nächsten Besuch wusste mindestens die halbe Kundschaft davon, jene Hälfte zu der sich auch Susi Wolf zählen durfte. Und Susi hatte der umtriebigen Ika schon länger von ihrem „Therapeuten“ erzählt, der ja eigentlich nur Lebensberater war, ohne jedoch seinen Namen preiszugeben, das sie ihn nur ungern mit anderen Frauen teilen wollte, schon gar nicht mit ihrer attraktiven Friseurin. Von dieser bei ihrem letzten Besuch angesprochen, ob sie dem verzweifelten Verlobten einer guten Kundschaft nicht doch dessen Namen nennen wolle, überlegte Susi kurz. Schon bald wich ihre Sorge, wegen der sie die Geheimniskrämerei um Peter betrieb, den dieser Möglichkeit innewohnenden Chancen. Besonders attraktiv erschien ihr die Möglichkeit, ihrem Lebensberater ein lukrativ anmutendes Geschäft zukommen zu lassen und sich auf diese Weise einmal mehr als unentbehrlich darzustellen. Also gab sie Name und Telefonnummer weiter und schon zwei Tage später hatte Donner eine Nachricht von K.H. Gessler persönlich auf der Mailbox, worin er zuerst um größtmögliche Geheimhaltung und gleich danach um einen sofortigen Termin bat. Ebenso teilte er diesem mit, dass Donner ihm von berufener Stelle empfohlen worden war. Peter stutzte, nachdem er die Nachricht abgehört hatte, vor allem die berufene Stelle machte ihm zu schaffen, hatte er doch bislang weder Kontakt zu Sicherheitsfirmen, noch in die Politik und schon gar nicht zur Partei für Recht und Ordnung, kurz PRO genannt. Er grübelte also, konnte sich vorerst keinen Reim machen, wollte aber doch genaueres wissen, wer ihn da empfohlen habe. Also beschloss er sofort zurückzurufen, und auch dieser Frage auf den Grund zu gehen. Seine diesbezüglich Nachfrage scheiterte aber an der von KHG nochmals geltend gemachten Geheimhaltung, die er ihm mit „Sie wissen ja, die Politik, da ticken die Uhren anders“ zur Kenntnis brachte. So kamen sie zu ihrem ersten Termin und Peter schmiedete die These, er wäre offensichtlich schon in weiteren Kreisen bekannt geworden als er sich jemals erhofft hatte. KHGs Pressesprecher wiederum machte – so wie es seine Art war – aus dem für ihn schlechten wieder mal das Beste. Er machte die Politikern immer wieder angelastete Beratungsresistenz zum Thema, die für Gessler, als Politiker einer neuen Generation, nicht galt. Sollte das Geheimnis also eines Tages an die Öffentlichkeit gelangen, wären mit dieser Erklärung sicher Punkte zu machen, so Pressesprecher Dragomir, der den klingenden Nachnamen Enstein trug, was ihm oft die Ehre zu Teil werden ließ, als Herr Einstein begrüßt zu werden, wogegen er sich niemals wehrte. Nun also stand dieser KHG zu seiner zweiten Doppelstunde vor Donners Türe. Und Donner bereitete sich darauf vor, die ihm in seiner Intuition während der letzten Stunde mit Susi Wolf anheim gefallene Idee vom Coming-out vor laufender Kamera an den Mann zu bringen. Dieser Tag hatte es wieder in sich gehabt. Donner entspannte sich gerade mit einem Glas burgenländischen Rotweins, den ihm ein ehemaliger Klient, ein Weinbauer, der ihn vor Jahren wegen seiner Eheprobleme aufgesucht hatte, zum vergangenen Weihnachtsfest per Post geschenkt hatte. Auf der beigelegten Grußkarte konnte man immer noch seine große Dankbarkeit ablesen und auch seine Bewunderung dafür, dass es durch Donners Begleitung gelungen war, einer am Ende befindlichen Beziehung zu einem neuen Frühling zu verhelfen, der immer noch andauerte.
Was Peter bei anderen gelang, misslang ihm regelmäßig im eigenen Leben. Seine Partnerschaften, wenn man sie überhaupt so nennen konnte, dauerten meist bloß einige Monate, von Frühling war nur in den ersten Wochen die Rede, diesen folgte meist unmittelbar ein stürmischer Herbst, ehe die ewige Eiszeit ausbrach. Von Zeit zu Zeit erreichte ihn von dort noch der eine oder andere Giftpfeil, meist in Form einer SMS oder einer E-Mail. In diesen Momenten brach in ihm ansatzlos die Gluthitze eines Sommers am Äquator aus und er missachtete alle Regeln der Konfliktbearbeitung, die er seinen Klienten regelmäßig wärmstens ans Herz legte. Das Mobiltelefon läutete, am Klingelton konnte Donner erkennen, dass seine Mutter ihn anfunkte. Das ließ ihn einen Moment zögern und erst nach dem fünften Läuten drückte er die grüne Taste am Display – nicht ohne zu hoffen, dass dieser Knopfdruck um das Bisschen zu spät erfolgte, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen. Erfolgreiche Verbindung waren nicht gerade die Worte, die einem einfielen, wenn man die Beziehung Peters zu seiner Mutter kannte. „Donner“ meldete er sich und musste sogleich zur Kenntnis nehmen, dass seine Gebärerin schlechte Laune hatte. „Was ist denn mit dir los?“, startete diese das Gespräch. „Wie kommst du auf diese Frage, Mutter?“, entgegnete Peter. „Was – wie jetzt – ist das eine deiner perfiden Techniken, um deine Gesprächspartner abzuwimmeln. Das zieht bei mir nicht.“ Und nach einem langen Schweigen setzte sie fort: „Du weißt, dass das mit den Gegenfragen bei mir nicht zieht. Ich will jetzt sofort eine Antwort!“ Donner überlegte, ob und wenn ja, was wirklich mit ihm los sei, und noch ehe er zu Ende denken konnte, begann seine Mutter von ihren Problemen mit seinem Vater zu quatschen und es begann eine der üblichen, kostenlosen telefonischen Eheberatungsstunden für die einzige Frau in seinem Leben, die dauerhaft an seiner Seite verweilte. Während sie also das Übliche von sich gab, hing Peter noch seinen Gedanken über die Frage seiner Mutter nach. Auf ihre regelmäßige Rückfrage „Peter, hörst du mir überhaupt zu?“, antwortete er automatisch mit „Was denkst denn du, Mutter?“ Das hatte sich in ihren Telefongesprächen schon seit Ewigkeiten so eingespielt, er wusste auch, an welcher Stelle er was zu sagen hatte und in der Regel endeten diese Telefonate mit Peters Tipp, es doch mal damit zu versuchen, ihrem Ehemann diese Dinge direkt zu sagen. Peters Mutter redete also und er selbst dachte weiter. Nachdem Susi an diesem Tag gegangen war, hatte er das übliche schale Seelengefühl, das andere schlechtes Gewissen nannten. Es war ihm rätselhaft, warum das immer so war. Er kannte das sonst nur von den vielen Telefongesprächen mit seiner Mutter, nach dessen Ende sich regelmäßig eine ähnliche, wenn nicht sogar die gleiche Stimmung einstellte. Der Klient danach, den Susi beinahe umgerannt hatte, war weiterhin in seiner Sackgasse geblieben und nicht bereit gewesen, mal zurückzuschieben und eine der vielen anderen Straßen zu nehmen, die vor ihm lagen. Für Peter waren diese Kunden anstrengend, weil sich so gar nichts bewegte, andererseits waren sie als Dauerbrenner die, die ihm sein Einkommen bescherten. Von diesem konnte er ausgesprochen gut leben, er hatte vor knapp drei Jahren diese Dachgeschosswohnung am Stadtrand gekauft, direkt gegenüber eines großen Tierparks, in dem die großstädtischen Waidmänner regelmäßig erfolgreich ihr Jagdglück versuchten und für ein paar tausend Euro pro Abschuss dank der den Park umgebenden Mauer ein Wildschwein ums andere erlegten. Hier saß er nun auf seinem Sofa, hörte seine Mutter reden und hing den Erinnerungen an den Tag nach. Die Intuition für Gessler hatte er nicht mehr an den Mann bringen können, da dieser knapp vor seiner Stunde abgesagt hatte. Gegen Bezahlung versteht sich. Bei ihm hatte Peter keine Skrupel und er knöpfte ihm das Doppelte seines üblichen Honorars ab. „Was nichts kostet, ist nichts wert“, erinnerte er sich in diesem Fall an eine der Weisheiten seiner Oma, um nur ja nicht auch in diesem Fall jenem schalen Gefühl zu verfallen, das er um alles in der Welt nicht schlechtes Gewissen nennen wollte. Woher er diese Aversion gegen das Gewissen hatte, war dem Donner immer unklar geblieben. Seine diesbezüglichen autodidaktischen Reflexionen hatten ihn zwar jedes Mal in seine Kindheit zurückgeführt; da vor allem zu seinem Vater, der seiner Mutter nach das ganze Unheil ihres und damit auch seines Lebens war. Aber kaum stand er dann in Gedanken vor ihm, stand er schon so was von an. „... hat er gesagt, dass er mich verlässt ...“ Peter wurde durch diese Worte seiner Mutter flugs aus seinen Gedanken gerissen und traute seinen Ohren nicht. Was er als nächste hörte war: „... das kann er mir doch nach all den Jahren nicht antun. Und du bist mit Schuld, hast du mir doch dazu geraten, die Dinge offen mit ihm zu besprechen.“ Schweigen, dann Schluchzen, dann wieder Schweigen an beiden Mobiltelefonen. Was hatte seine Mutter da gerade gesagt. Er rang mit sich und den Worten, die er nicht und nicht finden konnte. Als er sich gefasst hatte, trat er dem Schluchzen seiner Mutter entgegen. „Du wirst schon sehen, wenn er sich erstmal beruhigt hat, dann werdet ihr eine neue Gesprächsbasis finden. Es ist in der Regel so, dass ein Mensch, der nach so vielen Jahren erstmals mit den Wahrnehmungen seines Gegenübers konfrontiert wird, die so eklatant von seinen eigenen abweichen, einmal den Rollladen runterlässt. Kein Grund zur Sorge, Mutter. Du wirst sehen, jetzt geht’s aufwärts.“ Am anderen Ende der Leitung war das Schluchzen mit einem Mal verstummt. Peter klopfte sich bereits selbst anerkennend auf die Schulter, als das mütterliche Donnerwetter erst richtig losbrach. An dessen Ende hörte er den Satz: “Er hat bereits die Koffer gepackt und ist aus dem Haus gegangen.” Dann wieder Schluchzen. Peter räusperte sich und meinte: “Das ist ein gutes Zeichen, dass die Koffer noch da sind. Da kommt er noch einmal zurück und dann kannst du ihn dann wieder drauf ansprechen ...” “Du bist und bleibst ein Idiot”, replizierte Frau Donner grollend um gleich darauf wieder in herzzerreißende Tränen auszubrechen. Donner wusste nicht wie er sich der mütterlichen Umklammerung entziehen könnte und machte den Vorschlag, dass er mit Vater reden würde. Kurze Zeit später war dieses Telefonat beendet und er tippte die Nummer seines Vaters ins Handy. Es war kein Freizeichen zu hören sondern gleich das Tonband der Mailbox: “Donner hier, wenn du nicht Grete oder Peter bist, dann hinterlass eine Nachricht, ich melde mich wenn ich Lust habe.” „Wow“, dachte Donner, „das war eine klare Ansage!“ Da konnte er noch eine Menge lernen von seinem Vater. Er befolgte wie üblich die väterliche Anweisung, hinterließ also keine Nachricht und goss sich noch ein Glas des wirklich süffigen Rotweins ein. Von einer plötzlichen Melancholie befallen, holte er eines der Fotoalben seiner Kindheit aus dem Bücherregal. Am Buchrücken prangten in goldenen Lettern die Jahreszahlen 1972-1974. Gleich begann er gedankenverloren darin zu blättern. Das waren tatsächlich die goldenen ersten Jahre seines Daseins auf diesem verrückten Planeten, den zu retten er sich schon bald danach verschrieben hatte. Zuerst als umweltbewegter Aubesetzer, der seinen Großvater mit knapp 12 Jahren erfolgreich nach Hainburg begleitet hatte, in seinen langen Lehramts-Studienjahren an der Uni als Mitkämpfer der grünen Studierenden und schließlich- nach mehreren recht zähen Jahren als Deutsch- und Geschichte-Lehrer an einem Gymnasium der Hauptstadt - als diplomierter Sozial- und Lebensberater. Seine Ideale waren vom Großen zum Kleinen geschrumpft und er hoffte, durch die Rettung des Einzelnen die Welt verändern zu können. Nun stand in wenigen Tagen sein Vierziger bevor und irgendwie hatte er das Gefühl, das Leben liefe ihm immer schneller zwischen den Fingern durch. Er stellte das Album zurück ins Regal und rief nochmals seinen Vater an. Wieder das Tonband mit der Stimme seines Vaters. Doch diesmal ignorierte er dessen Aufforderung und las seinem Vater alkoholermutigt und daher ungeniert die Leviten. Der Donner war gerührt.
Eben hatte er eine seiner legendären Intuitionen gehabt. Was für die einen wie ein Lottogewinn war, also praktisch nie im Leben eintrat, stand für ihn plötzlich und unverhofft immer wieder auf der Tagesordnung. Meist in jenen Zeiten, in denen er mit dem einen Klienten, mit dem er gerade arbeitete, völlig anstand, offenbarte sich ihm für einen anderen, der gerade nicht anwesend war, eine bahnbrechende Lösung. Mit Susi Wolf war er wieder einmal am Ende angekommen. Sie saß am Ledersofa und hing seit Minuten angespannt und mit tränenerfüllten Augen an seinen Lippen, um diesen die erlösenden Worte zu entringen. Sein Blick fiel durch die Fenster, an denen der Regen wie Tränen herunterlief, zur Dachterrasse seiner Praxis, streifte das vom Sturmwind zerfetzte Papierschild, das seine Kollegin am rostigen Geländer angebracht hatte, um auf dessen Defekt hinzuweisen und vor dessen Berührung zu warnen, schweifte weiter in die Ferne und blieb am gegenüberliegenden Küniglberg und einer der Machtzentralen dieses Landes hängen. In diesem Moment wusste er, dass er K.H. Gessler zu einem Outing vor laufender Kamera raten musste. Er sprang aus seinem Lederfauteuil auf, nahm das Wasserglas vom gläsernen Beistelltischchen und ging Richtung Fenster. Als er am Sofa vorbeikam und noch bevor er einen Schluck nehmen konnte, fasste Susi Wolf seine Hand und hauchte: “Wir sollten es endlich miteinander versuchen!” Er blieb wie angewurzelt stehen. Sein ungläubiger Blick traf Susi ins Herz. “Ich meinte ja nur!”, nuschelte sie. Donner atmete tief durch. Er löste Susis Hand, stellte das Wasserglas zurück auf den Tisch und setzte sich ihr gegenüber zurück in seinen Fauteuil. Dann blickt er ihr tief in ihre wassergrünen Augen. “Du hast recht, Susi!”, sagte er entschlossen. “Oh, Peter, meinst du das ernst?”, fragte Susi und dann sprudelte sie los: “Du weißt gar nicht, was mir das bedeutet. Das ist, als wären die Spangen auf meiner Seele gelöst, eine nach der anderen. Pling. Und: Plong. Und: Plang. Hörst du das?” Donner starrte entgeistert in die Leere. Wo hatte er sich da wieder hineingeritten in den für ihn typischen Pferdegalopp, mit nur einem unbedachten Wort. Dieser spontanen Eingebung konnte er im Moment keinen heilsamen Charakter abgewinnen. Außerdem zweifelte er an der Richtigkeit seiner Intuition, denn Intuitionen haben ein Problem: wenn sie nicht aus der Tiefe des Selbst kamen, waren sie wertlos. Sie schienen dann bloß dorther zu kommen, waren aber mit ziemlicher Sicherheit Ansagen des Über-Ichs. Und wenn man da nicht höllisch aufpasste saß man damit auf der Gegenseite des Himmels, mitten in der großen irdischen Scheiße. So fühlte sich das jetzt an. “Schlaf nochmal drüber und lass uns in der nächsten Stunde weiterreden, nächste Woche selber Tag, selbe Zeit?”. Peter versuchte sich an Land zu retten, ehe ihm die braune Brühe bis zum Hals stand. Aber Susi ließ noch nicht locker. “Wir haben noch zehn Minuten, Peter” rügte sie ihn. Er blickte gedankenverloren auf seinen Aviator, der nur vorgab einer zu sein, weil dahinter eigentlich nichts als eine Batterie und ein Computerchip hausten. Aber er machte Eindruck. Nicht nur auf ihn. “Tatsächlich”, stellte er fest, nahm einen Schluck aus seinem Wasserglas, räusperte sich und sagte: “Na, dann leg mal los!” Die Wolf nahm das wörtlich. Während sie also ihre letzten zehn Minuten der laufenden Stunde nützte, um Altbekanntes wiederzukäuen, erlaubte sich Donner einen Exkurs in die Vergangenheit, genauer gesagt zurück zu jenem Moment, da er Susi kennen gelernt hatte. Es war noch gar nicht so lange her gewesen, im Sommer vor einem Jahr, da war er beschwingt, frisch verliebt und voller Tatendrang durch den nahe gelegenen Schlosspark spaziert. Plötzlich hatte er ein leises Wimmern gehört. Dazu muss man wissen, dass Peter Donner ein sehr feines Gehör hatte, vor allem für die Zartbesaiteten, Hilf- und Schutzlosen. Dieses hatte er schon vor vielen, vielen Jahren zum Beruf gemacht und damit bislang auch ganz gut verdient, aber noch mehr ausgegeben. Also, ob es nun ein Wimmern gewesen war oder ein leises Schluchzen, wusste er nun nicht mehr so richtig, ganz genau war es auch damals nicht zu definieren gewesen. Zuerst hatte er an das Jammern einer Katze gedacht und hatte seine Aufmerksamkeit schon anderem zuwenden wollen; da war es ihm wieder durch Mark und Bein gefahren und er hatte diesem, wie er meinte, Hilferuf unbedingt folgen müssen. In einer Seitenallee war eine Frau gesessen, in sich zusammengesunken so dass man nur noch den Berg ihres hochgesteckten roten Haares hatte sehen können, der aus der Halsöffnung eines getigerten Mantels herausgeragt war. Dieser hatte knapp über ihren Knien geendet, danach waren sehr schlanke Beine gefolgt, die in eine schwarze Nylonstrumpfhose mit Blumenmuster gehüllt gewesen und in viel zu große, hochhackige Boots gesteckt waren. Donner hatte es bei diesem Anblick direkt an ihre Seite gezogen und so hatte er sich wenige Sekunden später schon neben der – wie sich später herausgestellt hatte – jungen Dame sitzend befunden und ihr seine Hand auf ihre Schulter gelegt gehabt. „Was ist denn so schlimm?“, waren seine ersten Worte gewesen, die er Susi jemals anvertraut hatte. Daraufhin war das Wimmern in ein lautes, haltloses Schluchzen übergegangen, dem ein noch heftigeres und lauteres Schreien gefolgt war. In der Zwischenzeit war die Frau auch anderen zufällig Vorübergehenden aufgefallen. Während einige kopfschüttelnd weiter gezogen, andere schnellen Schrittes dem für sie Peinlichen der Situation entflohen waren, waren auch einige stehen geblieben, um Zeugen der Szene zu werden. Peter Donner war in seinem Element gewesen, er war wie der Fisch im Wasser geschwommen, war ob der wachsenden Zuschauerzahl aufs höchste motiviert gewesen und hatte im nächsten Satz der heulenden jungen Dame den Schutz seiner Lebensberater-Praxis wenige Gehminuten vom Ort des Geschehens angeboten. In diesem Augenblick hatte Susi kurz auf- und er erstmals in ihre wassergrünen Augen geblickt, die wie sich später noch herausstellen sollte manchmal auch wasserblau oder –grau werden konnten. Danach hatte sie sich mit beiden Händen fest an seinen rechten Oberarm gekrallt und das Schluchzen wieder aufgenommen. Es hatte ihn einige Mühe gekostet mit ihr aufzustehen und wegzugehen, da sich das ganze Gewicht ihres Dramas in ihren Körper gelegt zu haben schien. Aber auch diese Herausforderung hatte Peter Donner, wenn auch nicht mühelos, so doch gemeistert. Eine Stunde später war er mit der kompletten Vita von Susi Wolf vertraut gewesen. Das Klingeln der Türglocke holte ihn nun zurück in die Gegenwart. Susi saß mit offenem Mund am Ledersofa, so als wäre sie gerade mitten im Satz unterbrochen worden. Peter sah auf die Uhr, die Stunde war seit 5 Minuten um. Mit einem leise gehauchten „Du verzeihst“ ging er nach draußen um die Tür für den nächsten Klienten zu öffnen. Zurückgekehrt fragte er Susi: „Also, nächste Woche, selber Tag, selbe Zeit?“ Susi stand auf und antwortete schnippisch: „Wenn du meinst …“ Und fort war sie, wieder einmal ohne bezahlt zu haben. Er hörte noch ein überraschtes „Hopsala“ seines nächsten Kunden, den Susi wahrscheinlich gerade über den Haufen gerannt hatte und dann fiel die Tür seiner Praxis lautstark ins Schloss. Das war einer jener Momente, vor denen man sich als Vater immer fürchtet. Für Pertti waren es zwei Situationen, die ihn dieses Fürchten lehrten: nämlich keine Antwort auf eine Frage seines Sohnes zu haben oder ihm eine schlechte, eine sehr schlechte Nachricht überbringen zu müssen.
Gestern abends noch hatten sie sehr ausgelassen den Jahreswechsel gefeiert, es war der erste Silvester gewesen, an dem Matti erst zur gleichen Zeit wie seine Eltern ins Bett gegangen war – und das war gegen zwei Uhr morgens gewesen. Mit dabei war auch Mattis Eisbär gewesen, ein Kuscheltier, das er einmal von der Nachbarin bekommen hatte, als Vorschuss sozusagen. Ja, er musste ihr versprechen, dass er nie wieder so laut toben würde, denn sonst würde der Eisbär wieder weglaufen. Pertti und seine Frau waren in diesem Moment derart perplex gewesen, dass sie kein anderes Wort außer “Danke” herausgebracht hatten, während Matti begeistert vom weißen weichen Fell des neuen Bettgenossen auch nur “Ja, klar” gesagt hatte. Damals war er 4 Jahre alt gewesen. Heute, fast 6 Jahre später, lebte dieser Eisbär immer noch. Die Nachbarin hatte noch viele Male an die Wände geklopft und auch zwei böse Briefe geschrieben, geschehen war aber nichts. Weder war der Eisbär davon gelaufen, noch wurde jemals die Polizei gerufen oder die Hausverwaltung eingeschaltet. Allerdings hatte es doch einige Zeit gedauert bis Mattis Eltern sich wieder entspannt hatten und von ihrem “Sei nicht so laut, sonst rennt der Eisbär weg” wieder losgekommen waren. Matti hatte dann immer seinen Eisbären ganz, ganz fest gehalten - und kein Mensch der Welt hätte ihm diesen in jenen Momenten wegnehmen können; geschweige denn hätte der Eisbär eine Chance zum Weglaufen gehabt. Heute, mehr als sechs Jahre später, war der Eisbär also immer noch Mattis Lieblings-Kuscheltier, obwohl er bereits starke Gebrauchsspuren aufwies und sein Fell schon grau und stumpf geworden war. Dieses Geschenk der alten Dame von nebenan hatte allerdings zur Folge gehabt, dass sich Matti für das Leben der Eisbären zu interessieren begonnen hatte. Mehrmals hatte Pertti mit ihm den Helsinkier Zoo besucht, es waren auch viele Bücher mit und über Eisbären angeschafft worden und es hatte seither keinen Film mit einem solchen Wesen gegeben, den der Junge nicht gesehen hatte. Knapp vor dem Ende jenes Jahres, in dem er den Eisbären unter Auflagen überreicht bekommen hatte, hatte es eine Weltklimakonferenz gegeben, in der sich alle Staaten der Welt nach jahrzehntelangem Ringen auf eine Reduktion der Erderwärmung auf ein für diese erträgliches und für die Lebewesen des Planeten hoffentlich auch überlebensförderndes Ausmaß einigen hatten können. Auf diese Weise hatte man gehofft, das Steuer nochmal herumreißen zu können und die Folgen des Klimawandels einzudämmen. Noch knapper vor diesem Jahresende war es auf dem Nordpol zum ersten Mal seit es Messungen gegeben hatte, um knapp 30 Grad wärmer gewesen als üblich. Die Temperaturen waren sogar im leichten Plusbereich gelegen. Die Bilder, die damals in den Abendnachrichten gesendet worden waren, waren beängstigend gewesen. Pertti dachte an das für ihn schmerzvolle Dahinschmelzen von Schneemännern in den Wärmephasen oder am Ende des Winters im Garten vor dem Landhaus seiner Großeltern draußen vor der Stadt, als er noch ein Kind gewesen war. In diesen vergangenen sechs Jahren allerdings war es zu einer dramatischen Erwärmung der Winter am Nordpol gekommen und das Polareis war extrem schnell geschmolzen. Plusgrade waren in dieser Region nun keine Seltenheit mehr. Umweltorganisationen und Tierschutzvereine hatten mit verschiedenen Aktionen versucht, das Überleben der Eisbären zu sichern. In den ersten beiden Jahren waren zwei Drittel der Population durch Ertrinken gestorben, da das Eis immer dünner und damit nicht mehr tragfähig genug geworden war. Eine der ersten Ideen der von den Regierungen der an die Polarregion angrenzenden Staaten gebildeten Eisbär-Rettungs-Kommission unter dem verblüffenden Namen “Ice-Breaker” war es gewesen, die Bären an den Südpol umzusiedeln. Bloß hatte das Wetter dort nicht mitgespielt, denn die Erwärmung des Nordens hatte keineswegs zu einer Erwärmung des Südens geführt und dieser war daher nicht wie erhofft bewohnbar geworden. In weiterer Folge hatte man begonnen, die noch lebenden Eisbären einzufangen und in Zoos sowie eigens dafür geschaffenen Eisbären-Stationen mit annähernd natürlichen Lebensbedingungen aufzubewahren - dies war auch von der Erwartung geprägt, dass das Klima nach einer kurzen Phase doch wieder in seinen Normalzustand zurückkehren würde. Die Zeit war vergangen, aber die Situation am Nordpol hatte sich zum Entsetzen aller auf diesem Niveau stabilisiert. Auch an Matti waren die Ereignisse dieser Jahre nicht spurlos vorbeigegangen, es hatte vor einigen Jahren einen richtigen Eisbären-Hype gegeben. Die Zeitungen sowie die Radio- und Fernsehnachrichten waren voll von Eisbären gewesen und hatten ausführlich über deren Situation und die geplanten Rettungsversuche berichtet. Nachdem der letzte Eisbär ins Eisbären-Center nach Spitzbergen überstellt worden war, verebbte die Berichterstattung. Was nur mehr eingefleischte Eisbären-Fans mitbekommen hatten - und Pertti zählte aufgrund seines Sohnes dazu - waren die vergeblichen Versuche, die Fortpflanzung der Eisbären in den eigens für sie gestalteten Indoor-Polarlandschaften der Eisbärenstationen in Schwung zu bekommen. “Diese Viecher wollen einfach nicht mehr ...” hatte es einmal ein bekannter Forscher kurz und emotional zusammengefasst. Die Erde hatte schon viele andere Tierarten verloren, daher gewöhnte man sich an die Situation und an eine Welt ohne die Polarbären. Immerhin gab es ja genug Filmmaterial und diesmal musste man sich nicht mit bloßen Spekulationen zufrieden geben wie bei den von allen Kindern weiterhin geliebten Dinosauriern. Dennoch war es ein Schock gewesen, als Pertti in den Frühnachrichten dieses Neujahrstages hörte, dass das letzte Eisbärweibchen in der Nacht im Eisbärencenter von Spitzbergen verendet war. Und das, obwohl man vor wenigen Tagen noch ganz erfreut berichtet hatte, dass die Bärendame durch künstliche Befruchtung trächtig geworden war. Man hatte diesen großen Erfolg medienwirksam sogar mit Sekt und Kaviar gefeiert. Auch Matti war damals ein Stein vom Herzen gefallen und er hatte seinem Eisbären ins Ohr geflüstert, dass nun alles wieder gut wäre. Umso schwerer fiel es Pertti nun, da er seinen Sohn an diesem Neujahrsmorgen aufweckte, die traurige Nachricht zu überbringen, bevor dieser etwas spitz kriegte. Wie sollte er bloß beginnen? Nachdem sein Sohn sich in seinem Bett aufgesetzt hatte, fasste sich Pertti ein Herz. “Matti”, sagte er, “es ist etwas Trauriges passiert.” Dieser starrte ihn mit erschrecktem Blick an, doch noch ehe er etwas erwidern konnte, setzte Pertti fort. “Heute Nacht ist Mina, das letzte Eisbärenweibchen, in Spitzbergen gestorben.” Matti blieb weiterhin mit seinem starren Blick sitzen. “Es tut mir leid”, fügte Pertti hinzu und wollte seinen Sohn am Kopf streicheln. Dieser aber stieß ihn mit einer schnellen Bewegung seines Armes weg und rannte mit seinem Stoffeisbären ins Badezimmer. Dort schloss er sich ein. Als Pertti zur Badezimmertüre kam, hörte er von drinnen ein lautes, herzzerreißendes Schluchzen. Auf seine beruhigenden Worte reagierte der Junge überhaupt nicht, vielmehr schien es, als würde sein Weinen immer stärker. Er ließ seinen Sohn gewähren und ging in die Küche um sich einen Schluck Wasser zu genehmigen. Dabei überlegt er, wie er seinen Sohn beruhigen könnte. Schließlich weckte er seine Frau und bat sie um Hilfe. Aber auch Irmelis Bemühungen waren vergebens. Dem Schluchzen hinter der Badezimmertüre folgten heftige, hasserfüllte Worte. “Mörder”, schrie Matti. “Ihr Mörderbande, ihr!” Dann trommelte er mit seinen Fäusten von innen gegen die Türe und schrie erneut “Mörder!”. Irmeli und ihr Mann standen ratlos herum und wussten weder ein noch aus. Da klopfte es auch noch an der Wohnungstüre. Davor stand die alte Nachbarin, die wutentbrannt sofort die Rückgabe des Eisbären forderte, den sie Matti vor Jahren mit Vorbehalt geschenkt hatte. Pertti lud sie in seiner Verzweiflung ein, ihr Glück bei Matti zu versuchen. Er erzählte ihr in kurzen Worten, was vorgefallen war. Die alte Dame erstarrte und begann kurz darauf ungehemmt zu weinen. “Mörderbande!”, flüsterte sie. Als sie sich gefasst hatte, ging sie zur Badezimmertüre, klopfte und sagte mit starker, lauter Stimme: “Komm, Matti, genug geheult, lass uns diese Mörderbande finden und den Tod der Eisbären rächen.” Und kurze Zeit später ergänzte sie: “Und zuerst machen wir uns einen Kakao und überlegen uns, wie wir das am besten hinkriegen.” Es dauerte nicht lange, da öffnete Matti mit tränengeröteten Augen und ebensolcher Nase die Türe, seinen Eisbären unter den Arm geklemmt. Er nahm die ihm angebotene Hand, schaute seine Eltern mit eisigem Blick an, flüsterte ihnen ein heftiges “Mörder ihr!” zu und zog mit der Nachbarin ab. Am gleichen Abend kamen in den Nachrichten Forscher zu Wort, die es für möglich hielten, aus den in den letzten Jahren für alle Fälle aufbewahrten Stammzellen der Eisbären, solche zu klonen. “Wir werden uns doch von dieser primitiven Natur nicht unterkriegen lassen!”, so die eine. Und ein anderer: “Der Mensch ist doch die Herrenrasse hier, geboren um die Welt nach seinen Vorstellungen zu gestalten. Also lasset uns Tiere machen nach unserem Abbild.” Das breite Grinsen dieses Typen wirkte in Pertti noch lange nach. Immer schon hatte er sich gewünscht, den Weihnachtsabend am Strand zu verbringen, dabei eher an den Süden gedacht und an die milde, würzige Luft des Meeres und an einen Spaziergang in leichter, lockerer Bekleidung.
Nun schlenderte er am Ufer dieses großen Sees entlang, in der Nähe seines Mökkis im Südwesten Finnlands. Dieses kannte er von seinen Sommeraufenthalten bestens, hatte seinen warmen Nordpol-Stiefel aus seiner Heimat an und war in seine Icepeak-Jacke eingepackt, zusätzlich einen wärmenden Schal um Hals und Mund geschlungen und die Mütze tief ins Gesicht gezogen, so dass nur ein schmaler Schlitz für die Augen übrig blieb. Sehen konnte er ohnehin kaum etwas in dieser nördlichen Dunkelheit, die derzeit fast den ganzen Tag anhielt, obwohl die Wintersonnenwende schon wieder einige Tage zurücklag. Kalt und sternenklar lag diese noch mondlose Nacht um ihn, der wenige Schnee, der Anfang des Monats gefallen war, war längst wieder geschmolzen. So spazierte er also langsam und gemächlich, bloß seine eigenen Schritte und von Zeit zu Zeit das Brechen kleinerer Wellen des Sees hörend, der in der Windstille fast glatt da lag, blieb immer wieder stehen um in das Schwarz, das ihn umgab, zu blicken oder um am Nachthimmel die ihm vertrauten Sternbilder zu entdecken. In seiner Tasche hatte er eine Thermoskanne randvoll mit heißem Glögi, ebenso zwei Stück Roggenbrötchen, ein paar von den von ihm selbst frischgebackenen Weihnachtssternen und eine Aludecke für das geplante Picknick. Sein Kopf war in der klaren Winternachtluft voll mit Gedanken und vor allem Erinnerungen an die Weihnachtsabende seines nun schon mehr als vier Jahrzehnte währenden Lebens. Da gab es diese und jene, aber einen solchen wie heute, den hatte es noch nie gegeben. Er hielt ein weiteres Mal, atmete tief durch und schaltete die Stirnlampe ein, um sein mitgebrachtes Strandpicknick zu genießen. Er suchte das sandige Ufer nach einer passenden Stelle zum Sitzen ab und als er sie gefunden hatte, machte er es sich bequem. Wenig später saß er, mit nun wieder ausgeknipster Stirnlampe da, und genoss die mitgebrachten Köstlichkeiten. Der heiße Glögi dampfte und mit jedem Schluck füllte sich seine Körpermitte mit wohliger Wärme, die nach und nach auch die Gliedmaßen erreichte und schließlich auch seine Wangen erhitzte. Er hatte, um der Kälte vorzubeugen, auch einen Schuss Wodka dazugemischt, was sich jetzt eindrucksvoll bewährte. Der See lag immer noch fast glatt da, die eine oder andere Welle brach sich in unregelmäßigen Abständen am Ufer und die Nacht lag still um ihn. In der Ferne sah man von Zeit zu Zeit das Aufblitzen von Scheinwerfern oder Rücklichtern von auf der Uferstraße fahrenden Autos. Die Welt nahm auch heute ihren Lauf, obwohl doch mit diesem Fest eine Unmenge an Hoffnungen verbunden war, die regelmäßig enttäuscht wurden. Immer wieder hatte er erfahren wie sein Leben vor den Weihnachtsfeiertagen plötzlich an Fahrt aufgenommen hatte, als wäre ein stürmischer Nordwest plötzlich und unerwartet in die Segel seiner Jolle gefahren. Dann hatte er alle Hände voll zu tun, um der neuen Wetterlage Herr zu werden. Diese Dynamik war dann regelmäßig in der Nacht der Nächte zu Ende gegangen, meist mit einem unbefriedigenden Gefühl für ihn. Egal in welche Lebensverhältnisse es ihn verschlagen hatte, irgendetwas stimmte mit diesem Fest nicht - oder mit ihm und seinem Verhältnis dazu. Daraus war auch sein regelmäßiges Sehnen entstanden, den Heiligen Abend am Meer zu verbringen, weit fort von seinem alltäglichen Leben, geborgen in der Ferne mit dem freien Blick auf den Horizont und allein, um endlich eins zu werden mit dem Leben, seinem Leben. Er wollte endlich geboren werden, zu dem werden, was er war, aber immer noch nicht entdeckt hatte. Regelmäßig aber war er abgelenkt worden, hatte sich vielleicht auch ablenken lasse, es hatte immer dann, wenn er gerade das Gefühl hatte, der Durchbruch ins Sein stehe grade bevor, einen Umschwung in seinem Umfeld gegeben, der ihn zum Kurswechsel gezwungen hatte. Die Gründe dafür waren mittlerweile unzählige und die Zeit schien ihm davonzulaufen. Das spürte er jetzt hier am dunklen Seeufer ganz deutlich. Er nahm es wohl auch deswegen so intensiv wahr, weil er zum ersten Mal in seinem Leben wirklich allein war. Kein Mensch, der mit ihm mitgekommen war, um im Mökki die Feiertage mit ihm zu verbringen, auch kein Mobiltelefon, das ihn stören konnte, weil er es einfach abgestellt hatte. In diesem Moment packte er schnell seine Sachen, stand auf und begann weiter zu gehen. Nach einigen Schritten fiel ihm auf, dass er sein Tempo wesentlich beschleunigt hatte, fast so als wäre er in Eile oder auf der Flucht. Er blieb stehen und lächelte. Es gab keinen Grund wegzulaufen. Es gab vielmehr allen Grund jetzt bei sich zu bleiben und auf das zu horchen, was da in den letzten Wochen in ihm heranzuwachsen begonnen hatte. Langsam schlenderte er weiter, in sich und seinen Gedanken versunken, als er sich in etwas verfing, das da am Strand lag. Da er seine Füße nicht befreien konnte, schaltete er die Stirnlampe ein. Er hatte sich offensichtlich in einem dünnen, grünen Bootstau verheddert. Da er die Leine um seine Knöchel nicht loswurde, legte er die Tasche ab und setzte sich in den kalten Sand. Nach und nach gelang es ihm das eine Ende der Schnur, in das er sich verwickelt hatte, loszuwerden. Das andere Ende lag in der Dunkelheit, er konnte es nicht erkennen. Da der Schein seiner Stirnlampe nicht so weit reichte, zog er am Tau bis ein kleiner, rosafarbener am Seil befestigter Styroporquader in Sicht kam. Er schleifte das Ding zu sich heran und nahm es in die Hände. Auf den Quader war mit blauem Filzstift eine Telefonnummer drauf geschrieben. Er untersuchte das federleichte Stück Styropor auf andere Merkmale, konnte aber sonst keine entdecken. Sofort nachdem er die Telefonnummer entdeckt hatte, begann er in seinen Gedanken zu fantasieren. Da fielen ihm die banalsten und die wildesten Geschichten ein, jedenfalls war er mit einem Mal wieder herauskatapultiert aus seiner Welt und gefangen genommen von den Aussichten, die dieser Eintrag ermöglichte. Es waren viele Leben, die ihm durch den Kopf spukten, er wusste nicht, welcher Spur er folgen sollte, er ließ sich dahintreiben und bemerkte gar nicht, dass vor wenigen Minuten der Mond aufgegangen war und den See und die ganze ihn umgebende Landschaft in ein wahrlich gespenstisches Licht tauchte. Viele Minuten, ja sogar Stunden zogen dahin, ehe er der wieder Umgebung und seiner Existenz gewahr wurde. Er stand da am Ufer des Sees, erhitzt von seinen Gedanken und der Kälte trotzend, die Stirnlampe war längst erloschen. Der nahezu volle Mond machte nunmehr alles ganz hell. Er griff in seine Tasche und suchte nach seinem Mobiltelefon, das er für den Notfall mitgenommen hatte. Und um einen Notfall könnte es sich ja auch handeln bei dieser Botschaft, die aus einer Telefonnummer bestand, auf diesem Stück rosa Styropor. Hastig schaltete er das Handy ein, tippte den PIN in die Tastatur und wählte die Nummer. Er musste gar kein Freizeichen abwarten, denn sofort meldete sich eine tiefe, beruhigende aber dennoch seltsam anregende Frauenstimme, die von einladender Musik im Hintergrund begleitet wurde. Er hörte: “Hyvää Joulu-iltaa, sinullekin, yksinäinen mies kylmässä Joulu-yössä, täältä löydät lämpöä, rakkautta ja seksiä. Eikä se maksa kuin 6,66 euroa minuutissa, paina ykköstä ja puhu Tanjan kanssa, paina kakkosta ja Jenni viihdyttää sinua vaikka loppuillan tai paina kolmosta, niin pääset juttelemaan Annelin kanssa. On siis valinnan varaa ... “ , drückte die 3 und überließ sich dem Leben, ließ kommen, was da kommen wollte. Es ist so weit. Alle Jahre wieder in der zweiten Oktoberhälfte, dann wenn der Abend eines klaren Herbsttages anbricht, stellt es sich ein: das lila Leuchten. Und es ist nicht nur draußen, weit außerhalb der Stadt zu sehen. Es ist, wenn man einen achtsamen Blick dafür hat, überall zu entdecken, auch mitten in der Großstadt.
Das erste Mal ist es mir vor mehr als 20 Jahren aufgefallen, als ich in den bewaldeten Hügeln im Norden meines Heimatlandes meine Herbstferien verbracht habe. Ich bin mit meinen Töchtern bei einer Freundin meiner Frau, die ebenfalls eine Tochter hatte, zu Besuch gewesen. Sie hat für uns ein feines Quartier zurecht gemacht, das kleine Bauernhäuschen ihrer Eltern, das sein zweites Leben als Touristenunterkunft erhalten hatte. Es ist beschaulich am Rand des Waldes gelegen, abseits einer Forststraße, die kaum befahren gewesen ist. Als ich es am Nachmittag unseres ersten Ferientages in der letzten Oktoberwoche jenes Jahres erstmals zu Gesicht bekommen habe, habe ich den heiligen Schauer und die Verheißung, endlich zu Hause angekommen zu sein, verspürt. Ich habe ihn erst einige Wochen später, als ich mein Leben in der Hauptstadt wieder aufgenommen hatte, richtig deuten können. Die Sehnsucht nach diesem Haus, nach diesem Wald, nach diesen Tagen und nach ihr, die mich seither zumindest einmal im Jahr befällt, ist bis heute lebendiger Ausdruck dieses beeindruckenden Gefühls. Nun waren wir also im Haus angekommen und Melina hat mir die Schlüssel mit einem kecken “Fühlt euch wie zuhause” übergeben. Ihr Blick hatte die eine Sekunde länger gedauert als es belanglose Blicke zu tun pflegen. Damit ist dieser Moment zu einem besonderen Augenblick geworden - im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben uns für einen Spaziergang eine Stunde später verabredet, der dann töchterbedingt, später als geplant, schon in der Dämmerung dieses Tages stattgefunden hat. Er hat uns nur ein kurzes Stück in den Wald geführt, der in dieser Gegend sehr dicht steht, so dicht, dass es meinen Kleinen bald bange geworden ist an jenem Abend. Wir haben unseren Ausflug also sehr bald beendet und uns von Melina und Tochter kurz nach dem Zusammentreffen gleich wieder verabschiedet. Diesmal ist es ihr Händedruck gewesen, der mich noch bewegt hat, als die Mädchen schon im Bett gelegen sind. Er ist mir sehr vertraulich, ja auch vertraut vorgekommen obwohl wir uns doch vorher nur oberflächlich begegnet waren. Meine Frau und Melina hatten einander kennengelernt als auch Melina noch in der Hauptstadt gelebt hatte. Von da an waren die beiden hie und da miteinander unterwegs gewesen, und wir beide hatten uns nur in den wenigen Momenten gesehen, als Melina meine Frau von unserer Wohnung abgeholt hatte. Einmal oder zweimal waren wir gemeinsam mit unseren Töchtern in einem nahen Park gewesen, aber da hatte ich bereitwillig den Kinderdienst übernommen und die beiden Freundinnen hatten das Leben bequatscht. In der völligen Stille des Häuschens, in der ich sogar das Atmen meiner Töchter im Nebenzimmer hören habe können, fernab der alltäglichen Hauptabendprogrammroutine meines großstädtischen Zuhauses, habe ich versucht, dem Sinn dieses Händedrucks nachzugehen. Ich habe mich an dessen Wärme erinnert, ich habe ihn mit anderen Händedrücken zu vergleichen begonnen, ich habe mich trotz aller Bemühungen nicht mehr daran erinnern können, dass meine Frau und ich jemals einen Händedruck gewechselt hätten - und wenn doch, dann sicher keinen solchen. Ich habe mich in diesen Stunden im Fluss meiner Gedanken immer weiter von dort entfernt, wo ich erst wenige Jahre vorher Wurzeln zu schlagen beschlossen hatte. Ich habe zu träumen begonnen, was aus Melina und mir werden könnte, wenn ich diesen Händedruck ernster nähme als er womöglich gedacht war. Erst als meine jüngere Tochter mich mit ihrem albtraumerschreckten Schreien in die Gegenwart zurückgeholt hatte, habe ich wieder auf die Uhr geblickt. Es ist schon weit nach Mitternacht gewesen. Es ist also höchste Zeit geworden, ein paar Stunden Schlaf zu bekommen, um am schon begonnenen Tag einen guten, entspannten Vater abzugeben. Außerdem ist für den nächsten Nachmittag der Besuch einer Vernissage in einem nahe gelegenen Schloss am Programm gestanden, der in Begleitung meiner Töchter sicher auch die eine oder andere Herausforderung zu bieten hatte. Die Nacht ist traumerfüllt und schnell vergangen und ich bin mit dem Gefühl des zeitlosen Jetzt erwacht, das keine Vergangenheit und keine Zukunft kennt, nur diesen Augenblick. Verschwebendes Schweigen als ich ins Innere des Häuschens lauschte, ebensolches als ich’s durchs geschlossene Fenster nach draußen hindurchhorchte. Aber der Tag ist schon angebrochen gewesen, das grelle Licht der Sonne, die schon durch die Vorhänge ins Haus hinein geschienen hat und vor deren Helligkeit ich die Augen zukneifen musste, hat dies eindrucksvoll bezeugt. Nach einer kalten Dusche, die auf meiner Nachlässigkeit beruht hat, dass ich ob meiner Tagträume am Vorabend den Heißwasserspeicher nicht eingeschaltet hatte, hat der Tag schnell an Fahrt aufgenommen. Am Vormittag sind Melina und Tochter plötzlich vor unserem Haustor gestanden. Wir hatten uns eigentlich erst für den Nachmittag verabredet gehabt, um die Ausstellung im Schloss zu besuchen, daher bin ich überrascht gewesen. Es ist aber eine angenehme Überraschung gewesen, die allerdings schnell verflogen ist, als Melina angespannt den Wunsch geäußert hat, ich möge mich um ihre Tochter kümmern da sie noch einen wichtigen Weg zu erledigen hätte. Als Melina auch gegen Mittag noch nicht zurück gewesen ist, habe ich schon mal für die Mädchen und mich Spaghetti gekocht. Ich habe sogar eine Portion mehr gemacht, falls Melina nach ihrem wichtigen Weg hungrig ins Häuschen zurückkehren würde. Bloß gekommen ist sie nicht. Also habe ich den Mädchen auf dem Sofa in der Wohnküche eine Mittagspause verordnet, die sie nur leidlich angenommen haben. Immer wieder habe ich die drei zur Ruhe mahnen müssen, während ich im Schaukelstuhl vor dem Kachelofen meinen sorgenvollen Gedanken nachgehangen bin, wo Melina denn um alles in der Welt solange bliebe. Und dann hat es plötzlich an der Türe geklopft und die Mädchen sind sofort drauf los gestürzt, um der endlich zurückgekehrten Melina zu öffnen. Sie hat sehr mitgenommen ausgesehen, als sie ins Häuschen getreten ist, hat aber kein Wort über das in den letzten Stunden Erlebte verloren. Ihre Tochter hat mir dann mit ihrer Frage nach ihrem Vater einen Hinweis gegeben, so Melina die letzte Zeit verbracht haben könnte. Weder hat sie die für sie aufgehobenen Nudeln essen noch einen Kaffee trinken wollen, vielmehr hat sie ihre Tochter schnell angezogen und ist stante pede aufgebrochen. Kein Händedruck, kein weiterer Augenblick, ich bin verloren im Vorraum gestanden, von einem unbestimmten Schmerz erfüllt. Meine Töchter aber haben mich rasch wieder in den Alltag geholt. Die Fahrt zum Wasserschloss im Nachbarort wenige Stunden später in Melinas Wagen ist dann großteils schweigend verlaufen, also zumindest was uns Erwachsene betroffen hat. Die Mädchen haben sich auf der Rückbank des Wagens köstlich amüsiert und sind auch während der Vernissage noch recht überdreht gewesen. Dort angkommen sind wir den Bildern gefolgt, haben einen Raum nach dem anderen begangen, und haben mit den Kindern mehr zu tun gehabt als uns lieb gewesen wäre. Die Bilder jener Künstlerin, deretwegen ich mich schon so auf diesen Nachmittag gefreut hatte, haben nur Schatten geworfen, aber keinen lebendigen Eindruck hinterlassen. Irgendwie ist über alldem auch Melinas Stimmung gelegen, die ich nicht deuten habe können und zu der sie mir auch keinen Zugang verschafft hat. Auf der Rückfahrt dann, in der Dämmerung dieses klaren Spätoktobertages, sind wir direkt in einen beeindruckenden Sonnenuntergang hineingefahren. Die dunklen Wipfel der Wälder haben sich an einem tiefblauen Horizont abgezeichnet. Ein paar Schleierwolken haben die orangerote Sonne beim Untergehen begleitet. Als die Sonne am Ende der Ebene zu verschwinden begonnen hat, hat sich das Rot ihrer letzten Strahlen mit dem Blau des Himmels vereint und mir zum ersten Mal in meinem Leben das lila Leuchten beschert. Auch Melina ist von diesem plötzlichen Farbwechsel am Himmel aus ihren Gedanken erwacht und hat das Auto an den Fahrbahnrand gefahren. Wir beide sind unter dem Protestgeschrei unserer Töchter aus dem Auto gestiegen und haben uns das beeindruckende Schauspiel da draußen angeschaut. Als wir beide so auf der Kühlerhaube des Pkws gesessen sind, hat Melina plötzlich meine Hand genommen und leise und bedächtig vor sich hingemurmelt, dass das Leben doch schön wäre. Ich habe zu ihr hingeblickt, während sie immer noch meine Hand gehalten hat. Sie aber ist in seltsamer Übereinstimmung mit diesem Augenblick ins Lila des Abendhimmels versunken gewesen. Nun stehe ich hier am Fenster meiner Wohnung am westlichen Großstadtrand. Heute, in dieser Dämmerung Anfang November ist es - wie schon so oft seit jener Zeit - zurückgekehrt das lila Leuchten des Abendhimmels. Es entführt mich auch diesmal zu jenem Augenblick mit Melina am Straßenrand auf unserem Heimweg vor vielen Jahren. Es weckt auch heute wieder diese Geborgenheit des Zuhauseseins in Melinas Häuschen, das Einssein mit mir und der Welt, das ich damals zum ersten Mal so deutlich empfunden habe. Melina habe ich nach diesem Moment in den ersten Jahren noch das eine oder andere Mal gesehen, meist in Begleitung jenes Mannes, des Vaters ihrer Tochter für den sie damals ihren mir noch immer unbekannten Weg auf sich genommen hatte. Seit meine Töchter erwachsen geworden sind und ich von meiner Frau getrennt lebe, habe ich die Wälder des Nordens nie mehr besucht. Ich habe diesen Augenblick, der mir für immer gegenwärtig sein wird, niemals aufzuscheuchen versucht: Das Zuhause in den waldigen Hügeln im Norden und Melina mit ihrem sanften, lange währenden Händedruck und ihren Worten beim Blick ins und unserem gemeinsamen Sein im Lila jenes Abendhimmels. Er starrt ins Jenseits, mitten hinein in die Wälder, dorthin wo Ruhe waltet. Die Scheibenwischer ziehen ihre Bahnen, um den dichter werdenden Schneefall in Schach zu halten und ihm den klaren Blick ins Außen zu erhalten. Wie er hier an den Waldrand gelangt ist, daran fehlt ihm jegliche Erinnerung. Er weiß noch von seinem Aufbruch hierher nach den Schrecken des Morgens. In diesem Augenblick ist er sich seines Daseins bewusster denn je. Aus seinem No-Name-Leben hat es ihn heute früh hinein in die Mitte dieses Seins gezogen, das er lange schon ersehnt hatte.
Der Motor läuft noch, aus den Lüftungsschlitzen bläst ihm ein warmer, gleichmäßiger Luftzug entgegen, der ihm eine Erinnerung an eine ferne Zeit schenkt, als er von der Felsenküste aus übers sanft bewegte Meer geblickt hatte, einem sonnenuntergangsgeschwängerten Horizont entgegen. Damals hatte er mit einem Mal gewusst, dass da noch etwas kommen würde. Etwas, das ihn erheben würde über die Niederungen seines Lebens, ihn hoch hinauf katapultieren würde, dieser Sonne entgegen, frei wie Ikarus und mächtig, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen. In der Morgendämmerung dieses Tages hat er sich dazu ermächtigt, so viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte später. Er hat sich seiner Existenz entledigt, dieser fortlaufenden Erniedrigung durch eine Aneinaderreihung von Sachzwängen. Zuerst hat das sein Chef zu spüren bekommen, der seine Fähigkeiten nie erkannt hatte, eine Begabung, die ihm durch seine Kindheit in den Schoß gefallen war. Er war gestählt worden im Kampf mit dem Feind, er hatte sich fast 17 Jahre lang in einen Kokon begeben, hatte dem Orkan der väterlichen Worte und Taten getrotzt und dem flehenden Gejammer der Mutter, er möge doch bitte, bitte ihr Leben nicht zerstören. So viele Stimmen in seinem Kopf hatte er aushalten gelernt, hatte sich mit ihnen arrangiert, hatte sie einmal liebevoll schmeichelnd, dann wieder herrisch anfahrend zumindest für kurze Zeit zum Schweigen gebracht. So viele Masken hatte er tragen gelernt. Er war der brave Bub gewesen, der angepasste, der halt in der Schule nicht so recht funktionieren wollte, der aber mit Hilfe des Bitten und Bettelns seiner Mutter bei den Lehrern den Schulabschluss hingekriegt hatte. Er war der willfährige Junge gewesen, der eine Lehre zum Bankkaufmann, die ihm sein Vater bei einem alten Schulfreund vermittelt hatte, begonnen hatte. Er war der undankbare Sohn gewesen, der dieses Lehre abgebrochen hatte, und mit den Konsequenzen seines Fehlverhaltens leben lernen hatte müssen. Mit 17 war er auf der Straße gestanden, weggeworfen, ausgesaugt und nichtsnutzig, verstoßen für alle Zeiten - unter den Tränen seiner zu Tode bekümmerten Mutter, deren Leben nur wenige Monate danach zu Ende gegangen war. Friedlich entschlafen sei sie, hatte der Vater bei seiner Abschiedsrede am offenen Grab gesagt, an dem er als Zaungast teilgenommen hatte, hinter dem Grabstein von Erni, seiner ersten großen noch kindlichen Liebe, die mit 14 samt ihrer Freundin Bea mutig in die Ewigkeit geflogen war. Dorthin, wo sich damals auch seine Mutter mit Hilfe zweier Packungen Dormiol hineingeschlafen hatte. Ihren Abschiedsbrief hatte er erst beim Räumen der väterlichen Wohnung gefunden, einige Wochen nach dessen Tod, den dieser durch Ertränken seines Lebens im Alkohol hervorgerufen hatte. Darin hatte sie sich bei ihm entschuldigt, hatte von Buße gesprochen, die sie zu tun hätte, hatte von Todesstrafe gesprochen, die sie verdient hätte, weil sie seinem Seelenmord tatenlos zugeschaut hätte. Damit hätte sie das Leben ihres einzigen Sohnes so gnadenlos aufs Spiel gesetzt. Stolz wäre sie auf ihn gewesen, dass er es soweit gebracht hätte, dass er sein Leben ob seiner Stärke alleine zu meistern im Stande wäre. Zumindest das wollte sie sich als Gutschrift anrechnen lassen, wenn sie dereinst vor ihrem Richter stünde. Wo auch immer sie den Erfolg gesehen hat, den sie ihm mit diesen Worten zugeschrieben hatte, ist ihm bis heute nicht klar. Plötzlich schmerzt ihn seine linke Seite, wie von einer offenen Wunde geplagt lässt er sich in den Sitz zurückfallen und schließt für einen Moment die Augen. Er tastet nach seiner Herzgegend und als er die Augen wieder aufschlägt, sind seine Hände voller Blut. Er blickt an seinem Hemd hinunter, das blutgetränkt ist. Abermals schließt er die Augen. Die Bilder, die sich ihm bieten, sind so abscheulich, dass er schnell wieder ins Außen, in Richtung Ruhe schaut. Hat tatsächlich er dieses Blutbad angerichtet, das kurz zuvor wie ein Alptraum aufgeblitzt ist und ihn schweißgebadet zurückgelassen hat inmitten dieser weißen Pracht, die allen Kindern dieser Welt die helle Freude ist? Noch etwas blitzt auf in ihm, als er die schneebedeckten Bäume durch die Windschutzscheibe betrachtet. Ein Moment unbeschwerter Ewigkeit als er eines Morgens gleich nach Tagesanbruch heimlich aus dem Haus geschlichen war, hier an den Rand dieses Waldes, und sich ins Leben fallen lassen hatte. Er hatte Arme und Beine bewegt und auf diese Weise den knietiefen Schnee zur Seite geschoben. Kurze Zeit später hatte er sich selbst als Engel wiedererkannt, als einer von dem seine Großmutter ihm öfter erzählt hatte, er hatte die Schwerelosigkeit gespürt, aus der er kurze Zeit später wieder in seine Wirklichkeit gestürzt worden war. An diesem Tag, zurückgekehrt an den Rand seiner Zukunft, nimmt er nur noch die Folgen dieser Bruchlandung war, seine Versuche diesen kurzen Moment davor nochmals zu reproduzieren - so wie er es unzählige Male getan hatte, um der Wahrheit zu entkommen - misslingen und er sitzt da, hinter dem Steuer seines Wagens und sieht sich selbst als gefallenen, aus dem Paradies verstoßenen Engel; er selbst als Luzifer, der durch diesen Fall als verquerer Lichtträger Genötigte. Es war niemals leicht gewesen doch am Morgen dieses Tages ist plötzlich alles ganz einfach gewesen. Er hat sein StG 77 aus dem Spind genommen, die über einen langen Zeitraum bei diversen Schießübungen eingesparten Patronen vom Kaliber 5,56 ins Magazin geschoben, zwei weitere Magazine damit gefüllt und den Rest in die Jackentaschen gesteckt, und ist losgezogen über den Kasernenhof, aufs Ziel fokussiert: die Kanzlei seines Kommandanten. Er ist am überraschten Kompanieschreiber vorbeigestürzt, ist weiter gegen die Tür des Befehlshabers gestürzt, die seinem gewaltigen Fußtritt im Nu nachgegeben hat und hat sein Ziel Schriftstücke studierend an seinem Schreibtisch sitzend vorgefunden. 2700 m Höchstschussweite, 300 m Einsatzschussweite, theoretische Schussfolge 700 Schuss pro Minute, VO 990 Meter in der Sekunde. Wie oft hatte er diese Daten gebetsmühlenartig dem Meister der Einheit zackig ins Gesicht schleudern müssen. Er hat noch eine Sekunde gewartet und als der Blick seines Chefs auf ihn gefallen ist, hat er abgedrückt. Dauerfeuer. Nach zehn Schuss ist die Stimme ohne noch einen letzten Befehl geben zu können für immer verstummt, die Stimme, die ihn gequält und gequält hatte, die ihn erniedrigt hatte und ihm den letzten Tropfen der Hoffnung geraubt hatte. Diese hatte er in den Anfängen seiner Dienstzeit hier noch gehegt, da er der bessere Soldat als sein Vater hatte werden wollen. Er hat sich umgedreht, da sind plötzlich zwei, die sich auf ihn werfen haben wollen, hinter ihm gestanden und er hat nochmals abgedrückt. Dauerfeuer. Zwei weitere Mann gefallen im Krieg für das Gute, das Licht zurückzubringen in diese dunkle, verdorbene, gottlose Welt. Wenn das einer konnte, dann er, der vom Mal seiner Kindheit auserkorene Lichtträger. Er hat dann das Magazin gewechselt und ist mit der Waffe im Anschlag über den Kasernenhof gerannt, der in der Dämmerung des anbrechenden Tages noch ziemlich verschlafen dagelegen ist. Knapp vor der Ausfahrt hatte er seinen Wagen unverschlossen geparkt, ist in ihn hineingesprungen um in einem Höllentempo an den verdutzten Wachen vorbei jene Schranke zu durchbrechen, die ihn so oft von seiner Freiheit getrennt hatte. Ihr hatte er sich täglich ausgeliefert, an ihr war er oft minutenlang gestanden, ehe er zum Eintreten bereit gewesen war. Sie hatte ihm aber auch Sicherheit gegeben; dennoch hatte er sich hinter ihr so oft wie im Gefängnis gefühlt. Weiter ist es gegangen, in das Haus seiner Eltern, das ihm nach deren Tod wieder zur Heimstatt geworden war. Das Haus, in dem er mit der Gründung einer eigenen Familie alles auslöschen hatte wollen, das sein Leben so tragisch gezeichnet hatte. Er hatte alle Möbel ausgetauscht, die Zimmer gewechselt, den Wänden neue, lebendige Farben gegeben, hatte wie im Rausch an einem neuen, befreiten Leben gearbeitet, einem Künstler gleich, der auf diese Weise das Werk seines Lebens schaffen hatte wollen. Er hatte eine Frau gefunden beim Tanz am Feuerwehrfest, inmitten eines Schlagers seiner Kindheit, den seine Mutter schon so geliebt hatte, zu dem sie sich in der Küche so oft sanft gewiegt hatte. In diesen Momenten hatte sie diesen einzigartigen, glücklichen Gesichtsausdruck gehabt, der ihr im Rest ihres Lebens gefehlt hatte. An diesem Morgen ist seine Frau in der Küche gestanden und hat gerade die Milch aufgebrüht für das Fläschchen des Jüngsten. “Du schon wieder” waren ihre letzten Worte gewesen, ehe der Krieger des Lichts sie mit unzähligen Schüssen niedergestreckt hat. Nie wieder würde sie ihn mit ihren Vorwürfen quälen, nie wieder würde sie ihm mehr abverlangen können, als er zu schaffen vermochte. Nie wieder würde sie ihn im Kreise der Freunde der Lächerlichkeit preisgeben können, mit ihren abfälligen Bemerkungen über seine Männlichkeit seinen Männerstolz beschmutzen. Er hat sich zu ihr gekniet, ihr die Augen geschlossen und noch bevor die ältere Tochter ihre Mutter erreichen hat können, hat er auch sie im Flur vom Leben erlöst. Nie sollten seine Kinder das gleiche durchmachen müssen wie er, nie sollten sie das erleben, was ihm das Leben geraubt hatte. Auch zu ihr hat er sich kurz hingekniet, war ihr noch einmal sanft durchs Haar gefahren, hat auch ihr die Augen geschlossen. Er hat ihre Seele mit Engelsflügeln immer höher steigen sehen, doch war dieses Emporsteigen von unmenschlichem Wehklagen begleitet, das auch noch nachgehallt hat, als er in seinem Wagen schon Richtung Wald unterwegs gewesen ist. Aus dem Kinderzimmer ist das Schreien des Jüngsten zu hören gewesen, der auf seine Milch mit Honig gehofft hat. Stattdessen hat er noch Süßeres bekommen, den Frieden und jene Ruhe, die nur die Ewigkeit zu geben im Stande ist. Still und stumm und mit von den Tränen gequältem Gesicht ist er dagelegen, sein weißer Strampler hat sich binnen Sekunden rot gefärbt und seine Unschuld ist in diesem Augenblick endgültig gemeinsam mit seinem Leben gewichen. Ihm hat er nicht in die Augen sehen können, mit abgewandtem Blick hat er ihm noch einmal über den Kopf gestreichelt und dann auch die Augen seines Sohnes für immer geschlossen. Die Waffe liegt immer noch am Beifahrersitz als das Brummen des Motors und das rhythmische Geräusch der Scheibenwischer gleichzeitig mit der warmen Brise an den Stränden Kroatiens erstirbt. Es herrscht nun jene Stille, die sich seine Mutter für ihr Leben immer gewünscht hatte und die auch er besonders an den Weihnachtsabenden immer erhofft hatte. Eine Zeit lang starrt er noch der Ruhe entgegen, die die Wälder ihm jetzt für alle Zeit zu geben bereit sind. Er steigt aus dem Wagen, holt den Spaten aus dem Kofferraum seines Kombis und schreitet langsam, bedächtig und in Gedanken unter den Schutz der mächtigen Bäume, deren Leben lange vor seinem begonnen hatte. Im letzten Schweiße seines Angesichts hebt er einmal noch einen Schützengraben aus. Diesmal aber will er sich nicht mehr wehren und mit dem Gewehr im Anschlag auf den Feind warten, um sein Leben zu retten. Diesmal legt er sich nach getaner Arbeit in der Aushebung ausgestreckt auf den Rücken, starrt in die weiße Pracht, die in einem wilden Durcheinander vom Himmel stürzt, so wie er einst von dort oben gestürzt worden war. Sie löscht nach und nach das Rot seiner Taten und - sein Leben. |
Kategorien
Alle
Text-Archiv
Februar 2021
|
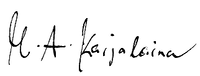
 RSS-Feed
RSS-Feed
