|
Mein Siegertext für den Schreibwettbewerb 2020, ausgeschrieben von der Stadtbücherei & Mediathek Krems unter dem Motto: "Schreiben in den Zeiten der Cholera": Er schaute sich in die Augen, fand sie rotgeädert, blickte weiter zu den grauen Ringen unter ihnen, den Falten, die aus ihren Winkeln sprossen, mehr als er in Erinnerung hatte, sah sein Gesicht blass und gealtert von der Schlaflosigkeit vieler Nächte und der verlorenen Zuversicht. Er fühlte sich fiebrig, in seinen Gliedmaßen tobte ein brennendes Ziehen, das ihm Sorgen bereitete. Sein In-den-Spiegel-Blicken erinnerte ihn an seinen Großvater, der Morgen für Morgen am Waschbecken in der Küche seiner Garconniere stehend, die er mit seiner Frau bewohnt hatte, einen prüfenden Blick in seine Augen geworfen und sie auf diese Weise auf den Gelbschimmer als Anzeichen einer befürchteten Hepatitis überprüft hatte. Er musste raus. Raus! Einfach raus! Seufzend rieb er sich Farbe auf die Wangen und wechselte aus dem Morgenmantel in sommerliche Kleidung, war die Temperatur doch am Beginn dieses Tages schon auf über 20 Grad geklettert. Er betrat den Garten, ließ sich vom leichten Lufthauch eines sanften Nordwest zu seinem Fahrrad tragen, hielt kurz inne, um den Duft des frisch gemähten Grases von einem der Nachbargrundstücke einzuatmen und auf sich und sein Gemüt wirken zu lassen und öffnete dann das Hoftor, um sich auf den Weg zum Supermarkt zu machen, wo er das Nötigste für die nächsten Tage besorgen wollte. Er mühte sich auf sein Rad, steckte einen der beiden Kopfhörer seiner Freisprecheinrichtung, die ihn mit seinem Mobiltelefon verband, ins linke Ohr, um durch die Begleitung der Morgensendung des Regionalradios den zu erwartenden Straßenlärm zu dämpfen und erinnerte sich an jene – manchmal heiteren, meist aber besorgten – Aussagen seiner langjährigen Lebensgefährtin, mit denen sie ihm zu sagen versuchte, dass er chamäleongleich zwischen einem jungen, athletischen und leichtfüßigen Mann und einem sich durchs Leben schleppenden, deprimierten und erschöpften Alten switchen konnte – und das innerhalb von Minuten. Heute fühlte er sich wie zweiterer, dessen Ende zeitnah bevorstünde. Auf dem Weg zum Einkaufszentrum überholte ihn ein LKW mit rumänischem Kennzeichen – wie schon so oft, ein toter Igel lag mitten auf der Fahrbahn – wie schon so oft, eine Mutter mit ihrem Kleinkind drängte sich auf dem viel zu schmalen Gehsteig an die Hausmauern, um sich in Sicherheit vor dem heftig und schnell vorbeirauschenden Straßenverkehr in diesem vermaledeiten 2000-Seelen-Ort zu wissen – wie schon so oft, in den Nachrichten, die durch den Kopfhörer aus seinem Handy in sein Ohr drangen, wurden die aktuellen Zahlen der Covid-19-Infizierten verlesen – wie schon so oft, und nochmals dringend zur Einhaltung der zur Bekämpfung der aktuell herrschenden Pandemie notwendigen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen aufgerufen – wie schon so oft in letzter Zeit, da eine zweite Infektionswelle nur dadurch zu verhindern wäre. Über ihm am Himmel zogen die Flugzeuge vorbei, im nicht bekopfhörerten Ohr nahm er in den Fluglärmpausen das Verkehrsrauschen der nahen Schnellstraße wahr. Wenige Meter nachdem er in die dichtbefahrene Straße zum Einkaufszentrum eingebogen war, sah er in noch einiger Entfernung etwas rechts von der Mitte seines Fahrstreifens liegen. Er dachte sofort an eine Katze, im Näherkommen wurde es immer klarer, dass es sich um einen Hasen handelte. Er fuhr langsamer, wurde dabei immer wieder von Fahrzeugen überholt, richtete einen Blick auf den übel zugerichteten Kadaver, der plattgedrückt, mit aus dem Körper hängenden Eingeweiden, blutverschmiert und mit nur noch einer Pfote da auf dem Asphalt lag. Die Autos polterten mit ihren gedankenverlorenen Fahrern mal knapp an dem getöteten Tier vorbei, mal direkt über es drüber. Ihm grauste. Leichen pflastern meinen Weg, dachte er, in regelmäßigen Abständen hatte er Zeit seines Lebens diese Erfahrung machen müssen, der Tote, den die Feuerwehr vor seinen Augen von den U-Bahngleisen der Hauptstadt, in der er den Großteil seines Lebens verbracht hatte, geholt hatte, die bereits abgedeckte Leiche auf einem Gehsteig ebendort, umgefahren von einem Autofahrer, der die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, die an ein Unglück erinnernde Kreidezeichnung auf der Straße an einer Kreuzung im benachbarten Ort und die Gliedmaßen sowie der Torso auf der Bahnstrecke zwischen seiner nunmehrigen Heimat und der Stadt, aus der er vor Jahren geflüchtet war und die er nur noch besuchte, wenn ihn die Sehnsucht nach jenem Café packte, in dem er so viele Stunden seines bisherigen Lebens schreibend verbracht hatte. Schreibend. Was ihm so viele Stunden, Wochen, Monate, ja sogar Jahre zum Segen gereicht hatte, was ihn entlastet hatte, was ihm die Lebenskraft zurück gebracht hatte, die lautlosen Schreie seiner Seele zum Ausdruck bringen hatte lassen, war schon vor geraumer Zeit versiegt. Er fand keine Worte mehr oder nicht die passenden – und ständig hatte er das Gefühl, dass alles, was da in ihm schrie und geschrieben werden wollte, eine einzige Anklage war, eine Ausgeburt seiner verqueren Moral, den Menschen sagen zu müssen, was richtig und was falsch wäre. Er konnte nicht mehr frei und befreit schreiben, zu sehr war er in den Strudel dieser kolportierten Katastrophe geraten, die die Menschheit mittlerweile über den gesamten Erdball lähmte, die ein Leben in Würde und Unabhängigkeit stündlich, wenn in den Nachrichten die aktuellen Zahlen der Neuinfizierten verkündet wurden, konterkarierte. Ein lautes Hupen schreckte ihn aus seinen Gedanken, er kam mit seinem Fahrrad ins Trudeln und musste abbremsen, fuhr zum Fahrbahnrand, stieg ab, packte die Kopfhörer weg und schob, von einer plötzlichen Unlust gepackt ohne seine Besorgungen erledigt zu haben, seinen Drahtesel wieder Richtung Zuhause. Diesmal nahm er die Schotterstraße durch den nahen Auwald, seine anfangs rasenden Schritte verlangsamten sich von Augenblick zu Augenblick, bis sie schließlich ihre Dynamik ganz verloren und er zum Stehen kam. Der Ruf einer Elster holte ihn von innen nach außen. Da lagen der Wald, der Weg, die Wiesen und Felder, ja selbst die Hallen und Gebäude des angrenzenden Gewerbegebiets in stoischer gleichwährender Ruhe, so als sei nichts geschehen. Keine Aufregung war spürbar, kein durch die aktuelle Situation gehetztes Hin und Her, kein … ja, rein gar nichts war anders in diesem Außen als zu jeder anderen Zeit, an der er hier, an dieser Stelle Halt gemacht hatte. Was sich gravierend verändert hatte, war sein Innenleben. Er war zerrissen zwischen einem Sehnen nach einem Leben im Gleichklang mit der Natur, dem Natürlichen, einer Existenz, die ihm ermöglichte, das zu tun, was ihn ausmachte und den von Jahr zu Jahr größer werdenden Anforderungen, sein Dasein nicht mehr auf Pump führen zu können, sich daher gezwungen zu fühlen, verstärkt diesem oder jenem Gelegenheitsjob nachzugehen, um existieren, ja um überleben zu können. Der Alte hatte nach und nach die Oberhand gewonnen, was ihm zwar zur Entschuldigung sich selbst gegenüber gereichte, ihm aber nach und nach auch sein eigentliches Wesen raubte. Als er so da stand, immer tiefer in den Wald hineinhorchte, wodurch die unnatürliche Geräusche der in allen Himmelsrichtungen liegenden Verkehrswege langsam verklangen, erinnerte er sich an die Stille und den Stillstand vieler bereits vergangener Tage in der jüngeren Vergangenheit, die eine Hoffnung in ihm hatte keimen lassen, dass alles anders, alles wirklich gut werden könnte. Kaum ein Auto auf den Straßen, kein Fluglärm vom Himmel, eine neue Häuslichkeit, die vielen ausgezeichnet stand, so manchen aber auch ins unsägliche Verderben innerer Höllen führte, in die er seine Umgebung gnadenlos mit sich hinabzog. Höllen, die sich auch im Außen, in den Lebensmittelläden bemerkbar machten, in denen Angst zu Gier wurde und Lebenswille zum Überlebenskampf. Die Zeit war lange schon reif für diese Wende, für eine Wendung, die den Menschen wirklich menschlich machte. Er hatte daran geglaubt, je länger der von der Regierung verordnetet Shutdow gedauert hatte, desto größer wurde seine Zuversicht, dass er alsbald davon leben könnte, was er für seines hielt, was er für richtig hielt. Wenn er es recht bedachte, hatte sich in diesen Glauben sehr bald schon ein schaler Beigeschmack gemischt, eine Bitternis, die er anfangs nicht wahrnehmen hatte wollen, die ihm aber letztlich auch das Schreiben vergällt hatte. Wollte er wirklich zum Moralisten werden, er der es – aus seiner Sicht - so gar nicht mit der Moral hatte, ein Erich Kästner der Gegenwart, ein Analyst des Ganges vor die Hunde? Ja! Er hatte sich in den ersten Wochen darin gefallen, es allen, der ganzen Menschheit mal so richtig rein zu sagen, hatte geschrieben, was das Zeug gehalten hatte, hatte geschrien, was er denen da, die diese Welt so verkommen hatten lassen, schon immer vor den Latz knallen hatte wollen. Und plötzlich war diese Wut versiegt, die ihn so mutig, ja übermütig gemacht hatte. Und mit einem Mal verstummte seine Tastatur, sein Schreiben hatte ein jähes Ende gefunden, sogar das auf diese Weise Entstandene musste fortan geschmäht werden, es war in den Tiefen virtueller und realer Papierkörbe verschwunden, war gelöscht oder gehäkselt worden. Doch an diesem jähen Ende, seiner Moralisierung gegen die Moral drohte er nun zu verzweifeln. Er stand lange so da am Waldrand und lauschte der Stille in all dem ihn auf der anderen Seite umgebenden Trubel, nahm diese Ruhe mit nach innen und erwachte erst im Sonnenuntergang, der ihm den Weg in seine Heimat wies. Nachts schlief er zwar von da an immer noch kaum, er wälzte sich jedoch nicht mehr schlaflose Stunde um schlaflose Stunde im Fegefeuer seiner Gedanken, sondern er gab ihnen Stimme, ließ sie im Klappern seines Keyboards aus der Wirklichkeit ins Phantastische gleiten und wieder zurück. Als er eines Tages, der Herbst war bereits ins Land gezogen und er hatte sich morgens mit einem Becher Kaffee im Garten stehend von der milden Sonne die Kälte der Nacht aus den Gliedern wärmen lassen, als er also dieses Tages bei einer weiteren Fahrt mit seinem Fahrrad zum Einkaufszentrum wieder dort vorbeikam, wo jener Hase seinen Tod gefunden hatte, erinnerte nur noch ein dunkler Fleck auf dem Asphalt an dieses Geschehen und an die Tatsache, dass Menschen sich vor Jahr und Tag unbedacht und mit Gewalt der Natur bemächtigt hatten und nun die Konsequenzen ihres Handelns tragen mussten.
0 Comments
für meine Liebste, meine Frau Reetta zum 10. Hochzeitstag am 18.8.2020 Weißt du noch damals, als wir noch nicht verheiratet waren, unsere Hochzeit aber längst geplant war, weißt du noch damals, als du mir in dieser mehr als beschissenen Zeit diesen Kugelschreiber geschenkt hast, damals, als ich meinen Dienst angetreten habe, antreten musste, meine Existenz, unsere Existenz abzusichern, meinen Dienst angetreten habe in den Mühlen des Arbeitsmarktservices, in jenem von diesem beauftragten Unternehmen, das zwei Maturakollegen Jahre zuvor in die Welt gesetzt hatten, um damit öffentliches Geld zu machen, als ich mich erniedrigt erheben wollte, um ein neues Leben zu beginnen?
Dieser Kugelschreiber, der heute, zehn Jahre später aus meiner vor kurzem erworbenen Schaffnertasche ragt, die nun alles Wichtige beherbergt, was ich früher in den Hosentaschen getragen habe, die Schlüssel, den Identitätsnachweis, Bargeld und Karten, mein Ideenheft, mein Taschenmesser, mein Mobiltelefon, den Spanngummi zum Befestigen meines kleinen Koffers an einem meiner beiden Fahrräder, in dem mein Laptop, mein Mittagessen, meine kabellosen Kopfhörer, mein Kalender, meine Erwerbsarbeitsunterlagen und die zur Wasserflasche umfunktionierte Ex-Bügel-Bierflasche Platz finden, dieser Kugelschreiber, der mir mit seiner silbernen Hälfte immer wieder zublinzelt, Licht und Schatten der am Zugfester vorbeifliegenden Landschaft reflektierend, dessen dunkle Seite, die schwarze, verborgen ist in den Tiefen des Außenfachs jener Tasche, dieser Kugelschreiber, den du mir damals in deiner Liebe geschenkt hast, die Liebe, die heute noch bei jedem Strich, den er in meinem Auftrag schreibt, aus ihm herausfließt, zieht mich in seiner zeitlosen Schönheit immer noch in seinem Bann. Er ist mir so kostbar, weil er in all seiner ihm innewohnenden Liebe, deiner Liebe, alles erfahren, erlitten, erduldet, erfasst hat, was mich in all diesen Jahren ausgemacht hat, mein Beichtvater gleichsam, er schrieb es nieder und nieder, wieder und wieder, das Intime, das zu Veröffentlichende, das Leben und alle, die darin eine Rolle gespielt haben. Das neue Leben ist längst alt geworden, er aber strahlt immer noch. Unsere Liebe hat ihre Höhen und Tiefen erlebt, wir gingen durch alle sieben Himmel und die eine oder andere abgrundtiefe Hölle, er, der Zeuge aber strahlt immer noch. Unsere Leben haben uns da und dort herausgefordert, überfordert, an den Rand unserer Abgründe geführt, in denen wir zu Grunde gehen mussten, um auf unseren Grund zu kommen, unsere Gründe, auf denen wir unser Lebensfundament bauen konnten, eines, das wirklich trägt – und er strahlt immer noch. Und nur, wer sich wirklich Zeit für einen genauen Blick auf ihn nimmt, wird den einen oder anderen Kratzer erkennen, die eine oder andere matte Stelle wahrnehmen, Spuren, die sich bei uns in der einen oder anderen Falte oder diesem oder jenem Schatten unter den Augen zeigen – an Tagen, an denen die Erschöpfung sich breiter macht als sonst. Das neue Leben ist längst alt geworden, unsere Liebe nicht. Unter all dem Ballast eines Lebens, das keinesfalls alltäglich ist, sondern immer abenteuerlich und all unsere Kräfte fordernd, strahlt sie oft unbemerkt wie ein kostbares Schmuckstück, das auf den Meeresgrund gesunken ist – unbemerkt auch von uns . Doch es lohnt sich wirklich, sie immer wieder aufzuspüren, sich ihr zuzuwenden, ihr Glitzern, ihr Funkeln, ihr Strahlen in uns aufzunehmen und sie in uns und für uns zu beleben. Dein Kugelschreiber, der in all den Jahren mein Kugelschreiber geworden und dein Kugelschreiber geblieben ist, ist heute noch und wird immerdar das lebendige Zeichen deiner Liebe in meiner alltäglichen Gegenwart sein. Buchstäblich. Mein Beitrag zum Welt-Sommer-Fest des Weltladens Tulln unter dem Motto "Lebensfreude/Lebenslust" am 6.8.20 I Als Marie in dieser Morgenstunde an jenem Sonntag Haus und Hof, die ihr bislang Heimat gewesen waren, verließ, dachte sie in keinem Augenblick an die, die damit zurückgelassen wurden. Hätte sie auch nur einen einzigen, winzigen Gedanken zu jenen gerichtet, die bislang ihr Lebensinhalt gewesen waren, die bislang ihr Leben bestimmt hatten, sie wäre wohl auf der Stelle umgekehrt und hätte alle ihre Pläne verworfen. So aber ging sie entschiedenen Schrittes und bloß mit einer Reisetasche bepackt in Richtung Bahnstation. Das Dorf schlief noch, war es doch erst kurz vor 4 Uhr. Sie wollte mit dem ersten Zug dorthin gelangen, wohin ihr Sehnen schon seit Jugend an gerichtet war, in die große Stadt, die Freiheit und Selbstbestimmung und noch dazu jede Menge Abenteuer verhieß. Mit jedem Schritt, den sie fest und bestimmt auf den Asphalt der Hauptstraße setzte, brach eine Spange um ihr Herz – und es waren deren viele, die es im Lauf der fast drei Jahrzehnte ihres bisherigen Seins umfangen hatten. Sie hatte zugelassen, dass es Vater und Mutter und ihre Geschwister, später dann ihre Freundinnen und noch später ihre Jugendliebe – wenn man ihren nunmehrigen Ehemann Markus so nennen konnte -, die Schwiegereltern und zuletzt die Zwillinge einschnüren hatten können. Ja und dann waren da natürlich auch noch der Hof, den sie von ihren Eltern übernommen hatte, die Verpflichtungen in der Pfarrgemeinde und im Kirchenchor sowie ihr Einsatz für den Klimaschutz, den ihr der Bürgermeister nachtrug und von Anbeginn megaschwer zu machen suchte. Nun also ging sie, in jener Morgenstunde, ohne auch nur den Funken eines Gedankens an das Vergangene und die mit ihrem Aufbruch Vergangenen zu richten, Schritt um Schritt den Weg, den vor vielen Jahren schon ihre beste Freundin Lea gegangen war, sie ging den Weg, den ihren. II Lea hatte die Schnauze voll. Gerade hatte sie wieder so ein Typ begrapscht – Gerd oder Fred oder wie auch immer sich die Vertreter dieser seltsamen Spezies namens Mann bezeichneten - es hatte sie also einmal mehr jemand begrapscht, weil er meinte, eine wie sie wäre Freiwild, wäre der nächste Fang auf der Jagd nach Samstag-Sonntag-One-Night-Stands. Obwohl sie schon – wie jedes Wochenende wieder - einiges intus hatte, setzte sie sicher und bestimmt ein Bein vor das andere, ließ jenen Club, in dem sie seit fast einem Jahrzehnt so ziemlich jede Samstagnacht verbracht hatte, hinter sich, verließ auch dieses Leben, das ihr zuletzt von Mal zu Mal enger und nunmehr zu eng geworden war, wand sich auf Schritt und Tritt aus dieser selbstgenähten Haut aus Freiheitsdrang, Abenteuerlust und Scheiß-auf-den-öden-Alltag und nahm Kurs auf den Hauptbahnhof. Ihre Sehnsucht lag in einer Heimat, in ihrer Heimat, jenem Dorf, das sie am Tag ihrer Volljährigkeit verlassen hatte; allen hatte sie damals alles hingeschmissen, keiner hatte sie verstanden, nicht einmal ihre beste Freundin Marie. Sie hatte allen Anfechtungen durch Hinz und Kunz widerstanden, hatte mit keiner Wimper gezuckt, hatte ihren Rucksack gepackt und war schließlich grußlos verschwunden. „Nie wieder“, hatte sie gedacht, „Nie wieder P-Dorf!“ Doch nun sah sie an genau jenem Ort ihre Zukunft, beschwor die duftenden Sommerwiesen, in denen sie sich so gerne gewälzt hatte, beschwor die eiskalten Winterstürme, die ihre Backen rot gefärbt hatten, beschwor die gute vom Küchenofen gewärmte Stube, in der sie lesend so manches Herbstwochenende verbracht hatte, beschwor auch die Freude an der überbordenden Kraft der Natur, die jeden Frühling beherrschte und versprach sich, nie wieder in die Großstadt zurückzukehren. III Der Zug war pünktlich. Marie sah die Landstriche, die ihr lange vorgegaukelt hatten, ihr Zuhause zu sein, an sich vorbeiziehen, ließ mit jedem Kilometer, den der Schienenbus sich fortbewegte, Tage, Stunden, Jahre ihres bisherigen Daseins hinter sich und dachte an das Kommende. Sie erinnerte sich in diesem Abschiednehmen an ein Gedicht aus ihrer Schulzeit, das sie damals ziemlich nachdenklich zurückgelassen hatte. Ein paar Verszeilen kamen ihr wieder in den Sinn, von Abschied war da die Rede, von Schmerz, aber auch von Lebenslust: „ … dass die Welt so schön ist, tut mir bitter weh, wenn ich schlafen geh … meine Lust ist Leben, doch sein Will gescheh‘, dass ich schlafen geh …“ Sie hatte keine Ahnung mehr, von wem der Text stammte, sie wusste nur noch um ihre Gefühle, die ihr Herz schnürten, als der Lehrer die Verse vorgetragen hatte. Darüber hatte sie sich aber mit niemanden aus ihrer Klasse, auch nicht mit Lea zu reden getraut. Und nun waren diese Zeilen plötzlich nicht mehr mit jenen Empfindungen verbunden sondern ermutigten sie, ja drängten sie förmlich, genau dem zu folgen, was der Dichter aus ihrer Sicht mit seinen Worten auszudrücken suchte: dem Leben lustvoll zu begegnen und es so zu leben, dass das Sterben seinen Sinn hatte. IV Der nächste Zug fuhr schon in zehn Minuten ab. Lea hatte also Glück mit ihrem Aufbruch, das Ticket hatte sie am Automaten in der Bahnhofshalle gelöst, dem Weggang stand nichts mehr im Wege. Während der Zugfahrt dauerte es eine ganze Weile bis sich die Häuserreihen der Großstadt lichteten, doch dann wurde der Blick zusehends freier, die ersten Felder säumten die Gleise, von Zeit zu Zeit tauchten auch Wälder auf, die in ihr Erinnerungen weckten an ein Gedicht, das sie beeindruckt hatte. Ihr Lehrer hatte es in einer Deutsch-Stunde vorgetragen, es galt den Text zu analysieren und zu interpretieren, eine öde Arbeit. Aber nicht deshalb hatte sie einzelne Verse im Gedächtnis behalten, sondern weil in ihnen von der Lebenslust die Rede war. Die folgenden Zeilen waren ihr zum Mantra bis zu ihrem Ausbruch aus den Zwängen ihrer Herkunft geworden: „...ach wie lebt ich gern, dass die Welt so schön ist, dankt ich Gott, dem Herrn … wie man Kinder abends ernst zu Bette ruft, führt der Herr mich schweigend in die dunkle Gruft … meine Lust ist Leben …“ Ja, sie wollte unbedingt Leben, bevor der Herr sie in die dunkle Gruft führen würde. Dieser „Herr“ wurde ihr zum Feindbild, seinem Willen wollte sie entkommen und die Stadt bot ihr dafür den besten Hintergrund, denn dort galt Gott als tot. Und so erlebte sie es dann auch. Jetzt aber hatte sie genug von dieser Gottlosigkeit, sie wollte heimkehren, dorthin wo das Leben und mit ihm der Tod ihren wahren Sinn entfalten konnten. V Zug und Gegenzug begegnen einander fahrplanmäßig in H-Burg. Marie blickt gedankenverloren aus dem Fenster. Lea steht auf, um ihr Fenster zu öffnen. Marie richtet ihre Aufmerksamkeit auf die Bewegung, die sie im gegenüberliegenden Schienenbus wahrnimmt. Lea schaut aus dem gerade von ihr geöffneten Fenster am Bahnsteig entlang, mehr unbewusst und in die Ferne. Da entdeckt Marie ein Gesicht, das ihr von Kindheit an bekannt ist, ihr Blick verweilt darauf. In dem Moment erkennt auch Lea die alte Freundin wieder. Noch ehe eine der beiden etwas sagen oder tun kann, setzen sich die Züge in Bewegung. Marie hebt ihre Hand hinter der Scheibe zu einem vorsichtigen Winken, Lea streckt ihren Arm aus dem Fenster, der anderen damit ein Zeichen gebend. Vorbei. Nur ein Moment. Doch in dem kurzen Blick, dem Augenblick, kommt eine Erinnerung hoch an einen längst vergangenen Moment, als beide Seite an Seite der Rezitation des Lehrers folgten: „ … meine Lust ist Leben ...“ Peter Rossegger Der Heringschmaus. Ein Aschermittwoch. Gebranntes Kind. Wollte ich nicht? Oder sollte ich nicht? Meine Träume von der Enge bis heute. Enge Höhlen, Enge Gassen. Enge Flugzeuge. Enge Zeiten. Meine Reaktionen, wenn ich mich in die Enge getrieben fühle: totstellen oder davonlaufen oder die Panikattacken.
Durchgehen scheint immer noch vermeidbar. Unmöglich. Ich musste doch. Aber es war keineswegs ein Highlight, das Licht der Welt zu erblicken. Ich legte mir gleich die Schlinge um den Hals. Exit schon vor dem Ankommen. Das Paradies nicht verlieren wollen, es dennoch verlieren müssen. Scheinbar. Denn was war da vor meinem In-Coming? Die Depression meiner Mutter. Der beginnende Alkoholismus meines Vaters. Unberechenbar. Kein gemachtes Nest. Überleben. Und der Heringschmaus, den ich meiner Mutter versaut habe. Und der Aschermittwoch, mit dem ich mich beladen habe. Beladen wurde? Eine lebenslange Last. Buße tun, die Schuld der Welt auf mich nehmen, Zum Sündenbock werden. Nicht nur einmal im Jahr in die Wüste geschickt werden, sondern immer und immer wieder. Verantwortlich gemacht werden, weil ich mich für alles und jedes verantwortlich fühle. In jeder Begegnung erzählen mir die Menschen ihr Leben, laden es mir auf. Der Obdachlose am Bahnhof, die Kollegin im Betrieb, der junge Mann bei meiner Lesung. Überladen. Überladung. Ich bin auf 180 – seit meiner Geburt. Der Druck enorm, Die Gegenwehr enormer. Die Chance, nicht geboren zu werden, zwar da, der Versuch gescheitert. Ich bin da. Physisch gesund. Die Seele aber leidet seither. Ich werde zum Menschenversteher, zum Seelsorger. Wer Seelsorger ist, sollte nicht unbesorgt sein über die eigene Seele. Wie aber geht das? Ich kämpfe mich von Geburt zu Geburt. Erlebe diesen Moment immer und immer wieder. Fluch oder Segen? Mal Fluch und mal Segen. Und ich lerne mein Geburtsmal zu tragen. Und ich lerne zu leben. Leben! Erstveröffentlichung am 30.10.2018 in WEGE - Das Magazin zum Leben, https://www.wege.at/wp-content/uploads/Menschenwege-3.18.pdf Entwurf einer Novelle, der im Oktober 2015 entstanden ist und mich beim Wiederlesen vor wenigen Tagen fasziniert und zur Weiterarbeit inspiriert hat:
Ein föhniger Südost trug sie nordwärts. Vorbei an aufgereihten Kürbissen, abgeernteten Maispflanzen und bereits wieder umgeackerten Zuckerrübenfeldern eilte der Zug zur tschechischen Grenze. Hie und da blitze in der aufgeräumten Landschaft der eine oder andere Weinberg, teils schon rotbelaubt aber doch noch voller praller Trauben. Knapp vor dem Landeswechsel verließen sie die Bahn, um am Parkplatz schon von Hilla erwartet zu werden. Mit einem alten 70er-Jahr-Käfer in rostumrandetem Hellblau ging’s noch eine knappe Viertelstunde weiter, draußen nichts Neues. Oder doch: Denn die Sicht auf die großteils flache, nur manchmal sanfthügelige Umgebung wurde ihnen von aneinandergereihten Straßendörfern verwehrt, in denen ein ebenerdiges Haus ans andere anschloss. So sehr sie einander im Baustil glichen, so sehr unterschieden sie sich in der Farbe ihrer Fassaden, die von mausgrau bis knalllila reichte. Was sich dahinter außer dem vom Vierkanter umschlossenen Innenhof verbarg mochte man nicht einmal ahnen. Greta und Marc waren auf der Flucht. Und sie suchten die Ruhe vor dem in der Großstadt tobenden Sturm gerade in diesem Landstrich, der dem Wein und damit der Wahrheit zugetan war. Kurze Zeit später standen sie vor dem prächtigen Gutshof der Weinbauerndynastie Maier, deren Weine den Weltruhm erlangten, den Hilla mit den von ihr gefertigten Skulpturen noch ersehnte, den ihr Gunter so lange schon wünschte und der dennoch mit keiner Million des höchst erfolgreichen Weinbaus zu erkaufen war. In der Mitte des mächtigen Vierkanters, der mit einem Stockwerk im der Straße zugewandten Teil protze, lag ein lichtdurchfluteter Glaspalast, Hillas Atelier. Im Wirrwarr der von weißem Marmor abgeschlagenen Teile stand ein männlicher Torso, vom Hals abwärts bis zu den Hüften bereits behauen, der Rest noch unkenntlich. Greta entfuhr noch vor dem Betreten der Werkstatt ein erregtes “Wow”, das sogleich durch eine abfällige Handbwegung Hillas relativiert wurde. Marc schaute und konnte dem Ausruf seiner Geliebten nicht folgen. Ihn nervte das Idealtypische des Torsos, der mit den üblichen Attributen des männlichen Oberkörpers ausgestattet war. Wo blieb die Kunst, fragte er sich, da doch nichts über die Wirklichkeit hinauswies. Wenn er allerdings an sein Spiegelbild dachte, überragte Hillas Werk jedenfalls seine Realität. Gespannt blickte er auf das, was hüftabwärts noch unbearbeitet dastand. Als er aus seiner Gedankenversunkenheit wieder aufblickte begegnete er Hillas kühlblauem Blick. Sie starrte ihn an, während er unversehens zu Boden schaute und Gretas Hand nahm. Sie betraten das Haus und landeten in einer großartigen Wohnküche, die so unbenützt aussah wie am ersten Tag. “Gunters Eltern haben sich immer Enkelkinder gewünscht, aber da bin ich absolut die falsche”, gestand Hilla um die beiden an den langgestreckten Esstisch einzuladen. “Weiß oder Rot?”, fragte sie lachend, und dann abgeklärter: “Oder doch lieber ein Gläschen Frizzante?”. Dabei funkelten ihre Augen als spräche sie vom Elixier ihres Lebens. Greta sah Marc an, der zuckte die Achseln, worauf Hilla lauthals den Schaumwein entkorkte und sie auf einen großen Jahrgang anstoßen mussten. “Gunter ist sonst ein ganzes Jahr nicht zu gebrauchen, wenn es kein großer ist heuer!” unterstrich sie ihren knapp zuvor vorgebrachten Toast. “Ihr müsst verzeihen, aber mein Göttergatte ist derzeit kaum im Haus, momentan schläft er sogar im Keller ... Er kann einfach nicht loslassen bis der letzte Tropfen abgefüllt ist.” Ein seltsam gurgelndes Lachen entsprang ihrer Kehle, das sie sogleich mit einem kräftigen Schluck Perlwein erstickte. Marc blickte auf ihren auf und ab hüpfenden Kehlkopf, der zu sehen war, weil sie beim Trinken den Kopf in den Nacken geworfen hatte. Die Hand, die das Glas hielt war fest und dennoch irgendwie zart, jedenfalls nicht so, als würde sie Hammer oder Meisel halten können, um damit Stein zu behauen. “So”, rief Hilla nachdem sie das leere Glas auf die Kücheninsel gestellt hatte, “und jetzt gehen wir was essen!”. Dann nahm sie Grete an der Hand und zog sie mit sich zur Tür. Marc folgte den beiden ein wenig später, folgte mit den Blicken Greta, folgte Hilla, die Jeans und Bluse trug und ein buntes Seidentuch über die Schulter geworfen hatte. An der Tür schlüpfte sie barfuß in blassrote Pumps, nahm mit einer lässigen Handbewegung, die sie sicher schon tausende Male gemacht hatte, noch den Schlüssel vom Bord und ging in den Innenhof. Grete blieb kurz stehen, sah sich um, bestaunte die bunte Blumenpracht, die dem Herbst etwas von der Sommerfrische gab, die man als Städter schon längst verloren glaubte. “Alles Schimäre”, rief Hilla und drehte sich um die eigene Achse, “aber mich unterhält’s!” Marc musste unwillkürlich lächeln, aber seine Augen machten es zu einem dieser traurigen Lächeln, die auf eine unerfüllte Sehnsucht deuteten oder einen verlorengegangenen Traum. Als das Hoftor ins Schloss fiel und die Stimmen der Frauen leiser und leiser wurden, entschied Marc seinen Blick noch einmal zum Atelier zu richten. Der Wind hatte gerade Wolken vor die Sonne geschoben, in diesem plötzlichen Dämmerlicht strahlte der weiße Torso eine die Zeit überdauernde Eleganz der ewigen Schönheit aus. Also möglicherweise doch Kunst, dachte Marc ehe er von der zurückkehrenden Greta mit einem “Wo bleibst du denn, komm doch endlich!” in die Gegenwart zurück katapultiert wurde. Nach einem üppigen Essen im “Winzerhof”, während sie schon beim Kaffee saßen, läutete Marcs Mobiltelefon. Ein Blick aufs Display genügte um sein Herz in Aufruhr zu bringen. Herzabwärts begann es zu rumoren und eine große Übelkeit befiel ihn. Sein Atem wurde schneller und an seiner Stirn bildeten sich Schweißperlen. “Probleme?”, fragte Hilla und da Marc nicht antwortete, assistierte ihm Greta: “Ach das übliche, zerbrochene Liebe, rachsüchtige Ex!” Hilla lachte laut auf: “Achso das!” um gleich danach noch einen Vogelbeer zu bestellen. Das Klingeln verstummte. Marcs Panik blieb ihm ins Gesicht geschrieben. Sie prostete den beiden mit einem “Vorbei ist bekanntlich vorbei! Also: Ex!” zu. “Wobei”, so ergänzte sie kurze Zeit später ihren Toast, “nicht immer kapieren das alle Beteiligten.” Dann begann sie davon zu erzählen, wie sie Gunter kennen gelernt hatte. Sie war auf der Suche nach einer Scheune für ihr Atelier mit ihrem VW in einem der Nachbardörfer angelangt und da sie den Weg verloren hatte, ging sie ins Wirtshaus am Hauptplatz. Dort stand gerade eine gröhlende Männerrunde an der Theke um weiß Gott was zu feiern. Jedenfalls seien, so Hilla, plötzlich alle verstummt als sie die Gaststube betrat. Und Gunter wäre der erste gewesen, der wieder den Mund aufgebracht hatte. Schönste, hätte er gesagt, nehmen Sie erst einmal einen kräftigen Schluck mit uns, der Rest wird sich finden. Nach mehreren kräftigen Schlucken hätte er sich angeboten, sie zum Objekt ihres Begehrens zu begleiten. Die Scheune lag wenige Minuten vom Ortskern entfernt am Fuß eines Weinberges. Sie sah schon ziemlich mitgenommen aus, im Inneren barg sie zwei leere Weinbergdraht-Rollen, einen Haufen vermorschter Spalierpfähle und achtlos in eine Ecke geworfene Scheren und Zangen sowie einen weiteren Haufen Drahtspanner. Es war düster und auch als sich ihre Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten, wusste sie, dass dieser Ort sich nicht als ihr Atelier eignete. Als sie sich zum Gehen umdrehte, stand Gunter vor ihr, legte seine kräftigen Hände an ihre Oberarme und schob sie an die Schuppenwand. Was dann geschah, könne sich ja wohl jeder denken. Ein zweiter Vogelbeer musste her, diesmal mussten auch Marc und Greta mittrinken. “Ex!” rief Hilla und Marc fragte, was sie denn nach dem geschilderten Akt des Kennenlernens veranlasst hatte, Gunters Frau zu werden. Das Piepen aus Marcs Hosentasche deutete auf eine neue Nachricht hin. Er zog das Handy heraus und schaute gebannt auf das Display. Eine neue Sprachnachricht von 270 Sekunden wurde ihm da angekündigt. Schnell ließ er es wieder in der Tasche verschwinden und bestellte eine Runde Vogelbeer. Der besorgten Greta entgegnete er: “Lass uns das Leben feiern, dazu sind wir schließlich hier!” Nach einer weiteren Runde zahlte er schließlich für alle, man musste sich ja für Hillas Gastfreundlichkeit erkenntlich zeigen. Auf dem Rückweg zum Winzerhof überkamen ihn die Gedanken, die er versucht hatte mit dem Schnaps zu betäuben. Sie waren heftiger als befürchtet und nahmen ihm für kurze Zeit den Atem. Gut, dass die beiden Frauen schon einige Schritte voraus waren, er wollte keineswegs in dem für ihn erbärmlichen Zustand gesehen werden. Er dachte an die Abmachung, die Bea und er getroffen hatten. Er dachte daran, dass sie möglicherweise bei seinen Sachen etwas gefunden haben könnte, das auf Greta hinwies. Er dachte daran, was sie ihm da wohl auf die Sprachbox gequatscht hatte und spürte, dass ein Verhängnis seinen Lauf zu nehmen begann, dass er um alles in der Welt lieber vermieden hätte. Dennoch hatte er nicht den Mut, die Nachricht abzuhören. Er nahm einen tiefen Atemzug der föhnigen Herbstluft, der ihn aber kaum erfrischte, und machte sich auf den Weg den beiden nach. Auf Drängen meines jüngsten Sohnes, der aufgrund meines Hörbuchs von Olli und der Weihnachtsmann nicht nur ein Olli-Spezialist ist, sondern auch sehnsüchtig auf die Fortsetzung wartet, habe ich mir heute ein Herz gefasst und mit Teil II der Olli-Story begonnen. Hier gebe ich allen ebenso Interessierten einen ersten Einblick in die Rohfassung der ersten Seite des ersten Kapitels. Wer mein erstes Olli-Buch noch nicht kennt, kann sich hier einen Gusto holen und es bei Gefallen für sich oder die Familie als E-Book und/oder Hörbuch bestellen ! Weihnachten kommt früher als man denkt! :-D
Der Winter dauerte. Olli hielt Teppo, seinen Hasen, den er an Weihnachten von Niina und ihrem Mann, dem alten Olli geschenkt bekommen hatte, auf seinem Schoß und streichelte ihn. In den letzten Tagen hatte der kaum gefressen und Olli machte sich Sorgen. Mama beruhigte ihn dann mit so Worten wie: „Das wird schon wieder!“, „Vielleicht wartet er schon auf den Frühling.“ oder „Wenn’s in ein paar Tagen nicht gut ist, dann gehen wir zum Tierarzt.“ Jetzt waren aber schon mehr als ein paar Tage vergangen und Teppo ging es immer noch nicht besser. Da weder Aussicht auf Frühling bestand, obwohl es schon Mitte April war und das Osterfest am kommenden Wochenende vor der Tür stand, noch die von Mama erhoffte Besserung eingetreten war, beschloss Olli im Telefonbuch nach einem Tierarzt zu suchen. Also setzte er seinen Hasen zurück in den Käfig, der im Zimmer stand, das er mit seinem älteren Bruder Mikko teilte, und ging dann in die Wohnküche. Das Telefonbuch musste in der Lade der Kommode liegen, zumindest hatte er es Mama schon das eine oder andere Mal dort herausnehmen und hineinlegen sehen. Er versuchte die Lade zu öffnen, aber nach einem kurzen Ruck klemmte sie. So sehr er auch zog, sie bewegte sich kein Stückchen weiter. Also versuchte er die Finger beider Hände in den schmalen Spalt zu schieben, der schon entstanden war – und tatsächlich gelang es ihm, die Lade noch ein Stückchen weiter zu öffnen. Da lag das Telefonbuch, gleich ganz oben. Trotzdem kam er noch nicht wirklich ran. So nahm er seine ganze Kraft zusammen und zog mit beiden Händen an der Lade. Diese gab nach einer kurzen Zeit ihren Widerstand auf und sauste mit einem Ruck aus der Fassung. So schnell konnte Olli gar nicht schauen, da lagen er, die Lade und deren Inhalt am Boden der Wohnküche. Olli rappelte sich hoch, rang nach Luft und hielt sich eine Zeit lang sein schmerzendes Hinterteil. Dann begann er die Dinge, die verstreut auf dem Boden lagen, einzusammeln. Das Telefonbuch legte er vorsorglich auf den Küchentisch. Als er die Lade hochhob und wieder in die Fassung zurück schieben wollte, zerfiel diese in mehrere Teile. Dabei fiel wieder alles auf den Boden. Das auch noch, dachte Olli. Was würde Mama wohl dazu sagen? Wahrscheinlich eines ihrer berühmten seufzenden „Ach, Olli!“ Vielleicht konnte er es ja selber wieder gut machen, in der Abstellkammer gab es sicher irgendwo Leim und wenn nicht, konnte er zum alten Olli gehen. Der hatte sicher welchen. Eigentlich war der alte Olli ja gar nicht so alt, aber der junge Olli, also er, hatte beschlossen sich nicht Kleiner Olli nennen zu lassen, nur damit der andere Großer Olli genannt werden konnte. Als er die Teile der zerborstenen Lade aufklaubte und auf die Kommode legte, fiel ihm ein Brief auf, der unter den vielen Sachen, die aus der Lade gefallen waren, zum Vorschein kam. Er war schon geöffnet. Olli schaute auf die Adresse und den Absender. Da standen in Papas Handschrift sein Name und seine Adresse in Deutschland und ihre Anschrift hier in Finnland. Sie waren ja letzten Sommer plötzlich und unerwartet mit Mama nicht nur auf Urlaub gefahren sondern wirklich hierher gezogen und geblieben, nachdem Papa eines Tages aus ihrem Leben verschwunden war. Zu Weihnachten war er dann plötzlich mit einer neuen Frau an seiner Seite aufgetaucht. Mit Hilfe des Weihnachtsmannes, den Olli kurz zuvor persönlich kennen gelernt hatte, war das Fest dann ganz gut verlaufen, obwohl Mama und Papa ansonsten sehr oft stritten. Olli wusste nicht, ob er den Brief lesen sollte oder nicht., also steckte er ihn in seine Hosentasche und machte sich an seinen eigentlichen Plan, einen Tierarzt für seinen Hasen zu finden. Leseprobe aus meiner Weihnachtsgeschichte für Jung & Alt mit Illustrationen von Irmi Studer-Algader Wo ist der Weihnachtsmann?
Er hatte lange warten müssen, fast eine halbe Stunde, doch dann saß er endlich im Bus. Das Ticket hatte bloß 2 Euro gekostet, billiger als erwartet. Für die Rückfahrt brauchte er nochmals dasselbe, also blieben ihm noch 6 Euro übrig. Da hätte er sich von Mama gar nichts ausborgen müssen. Olli ärgerte sich, denn wie er seine Lüge um die 5 Euro wieder in Ordnung bringen konnte, wusste er nicht. Er verschob diese Gedanken auf später und schaute gespannt in die Dunkelheit. Wo musste er nur aussteigen? Er traute sich den Busfahrer nicht zu fragen und beschloss bis zur Endstation zu fahren. Die Fahrt dauerte fast eine Stunde. Da stand er dann in der Kälte, weit weg von zuhause. Ihm war aber ganz warm, da sein Traum, den Weihnachtsmann zu treffen nun bald wahr werden würde. Vor ihm waren viele Häuser, einige wenige waren beleuchtet, und an fast jeder Ecke gab es einen Weihnachtsmann, allerdings nur aus Plastik. Die wenigen Leute, die mit ihm aus dem Bus gestiegen waren, verschwanden einer nach dem anderen in diesen Häusern und schon bald war er alleine auf der Suche nach dem Weihnachtsmann. Wo konnte der bloß stecken? Olli irrte eine lange Zeit zwischen den Häuserreihen herum, er wusste bald nicht mehr weiter und seine Freude wich zusehends einem unguten Gefühl in der Magengegend. Seine geniale Idee kam ihm jetzt plötzlich ganz, ganz dumm vor. Die Schultasche wurde auch immer schwerer. Er dachte an zuhause, an sein Zimmer, an den Ofen, der sicher schon heizte. Ein paar Tränen stiegen ihm in die Augen und er musste sich sehr beherrschen, dass er nicht gleich losheulte. - Verdammt noch mal, wo bist du blöder Weihnachtsmann, schluchzte er in die Nacht hinein, ich hab an dich geglaubt aber du bist nicht da! Olli blieb stehen und lauschte. Von der Straße war hie und da ein Auto zu hören, sonst war es ganz still. Er beschloss zurück zur Bushaltestelle zu gehen und lieber wieder nachhause zu fahren. In den vielen Gassen des Weihnachtsmanndorfes hatte er sich aber irgendwie verlaufen, alles sah gleich aus, der eine Weg wie der andere. Olli war nahe daran zu verzweifeln. Er blieb einmal mehr stehen und versuchte klare Gedanken zu fassen. Da hörte er plötzlich hinter sich Schritte im Schnee. Jetzt ging es darum, den ganzen Mut zusammenzunehmen, und den nächstbesten Menschen, der ihm begegnete nach dem Weg zu fragen, obwohl das Mama verboten hatte, jemanden Fremden anzusprechen. Olli drehte sich um und – da stand auf einmal der Weihnachtsmann vor ihm. Größer als er ihn sich vorgestellt hatte und nicht so dick wie auf den Bildern. Er hatte seine Mütze abgenommen und darunter war kein weißes, lockiges Haar. Als der Weihnachtsmann Olli sah, setzte er sich seine Mütze wieder auf und mit einem Mal hatte er auch wieder weiße Locken. Olli war kurz verblüfft, dann fasste er sich ein Herz und fragte auf Finnisch nach dem Weg zum Bus. Der Weihnachtsmann fragte ihn etwas, was er nicht verstand. Da sagte er ihm auf Finnisch, dass er noch nicht so gut sprechen und verstehen konnte. - Welche Sprache sprichst du denn (finnisch), fragte ihn der Weihnachtsmann. - Deutsch, antwortete Olli. - Gut, sagte der Weihnachtsmann, dann will ich versuchen auf Deutsch. - Ich habe einen Brief geschrieben, brach es aus Olli heraus, warum antwortest du nicht? Der Weihnachtsmann war verblüfft. Er schaute so drein, als ob er doch nicht so gut Deutsch verstünde. Olli wiederholte seine Frage. - Aber jetzt bin ich doch da, schmunzelte der Weihnachtsmann, was kann ich tun für dich? - Ich will zurück nach Wien, in meine Schule zu meinen Freunden und den Papa will ich auch wieder haben. - Das sind große Wünsche! - Aber du bist doch der Weihnachtsmann, sagte Olli wütend, und ich verzichte auch auf alle Geschenke an diesem Heiligabend. Und ich glaub an dich! Der Weihnachtsmann wurde stumm. Es wirkte so, als ob er nachdenken müsste. - Wo ist Papa, fragte er Olli dann. - Weiß nicht, sagte dieser, verschwunden! - Müssen wir ihn suchen! - Ja, bitte! - Vielleicht er ist schon gegangen nachhause? - Nö, da ist nur Mama. Und Mikko, mein Bruder. Und Teppo, der Hase, der bei mir wohnen soll. Das wünsche ich mir auch zu Weihnachten. - Große Wünsche, wiederholte der Weihnachtsmann und kratzte sich am Kopf, erst bringe ich dich zu Mama. Olli wusste nicht, was er darauf sagen sollte, aber da ihm bereits ziemlich kalt aber und er schon großen Hunger hatte, fand er die Idee gar nicht so schlecht. -Wo ist dein Haus, fragte der Weihnachtsmann. Olli nannte ihm die Adresse. - Ein weiter Weg, meinte der Weihnachtsmann, da wir nehmen Auto. - Nicht den Schlitten, erwiderte Olli. - Nur an Weihnachten, sagte der Weihnachtsmann, das dauert noch! Dann stapften sie durch die Häuserreihen und kamen zum Parkplatz bei der Straße, auf der auch der Bus gehalten hatte. Olli hatte ein blödes Gefühl, weil ihm Mama absolut verboten hatte, zu jemandem Fremden ins Auto zu steigen. Aber es war doch der Weihnachtsmann, beruhigte sich Olli. Bald schon fuhren sie in einem alten Pickup, einem Wagen mit einer großen Ladefläche durch die dunklen Straßen in Richtung Rovaniemi. Kurze Zeit später kamen sie bei Ollis Zuhause an. Das Haus war hell erleuchtet und auch Niina und der alte Olli waren da. Mama stand vor der Eingangstüre und telefonierte aufgeregt. Olli spürte gleich, dass etwas nicht in Ordnung war. - Nur Mut, sagte der Weihnachtsmann und klopfte ihm auf die Schulter, lass mich machen. Dann zwinkerte er ihm auch noch zu. Olli fühlte sich dennoch nicht sonderlich wohl. Der Weihnachtsmann nahm Olli an der Hand und begleitete ihn zur Veranda. Mama hörte auf zu sprechen, nahm das Handy vom Ohr und lief Olli entgegen. Ständig rief sie „Olli, Olli, wo warst du bloß!“ Dann umarmte sie ihn heftig. Das tat richtig gut. Und sie schien gar nicht böse zu sein. Da hatte Olli sich aber dann doch getäuscht, denn nur kurze Zeit später, fing Mama ganz wild zu schimpfen an. - Nicht schreien, Frau, sagte da plötzlich der Weihnachtsmann, ist alles gut. - Nichts ist gut, fuhr ihn Mama an. Und zu Olli sagte sie: Wie kannst du nur in das Auto eines fremden Mannes steigen? - Ist doch der Weihnachtsmann, sagte Olli mit tränenerstickter Stimme. - Das ist mir jetzt völlig egal, auch zum Weihnachtsmann darfst du nicht ins Auto steigen. - Alles gut, wiederholte nun der Weihnachtsmann. Ihr Kind ist wieder da. Hat große Wünsche. - Welche Wünsche denn? Mama war wirklich empört! Eine Zeit lang sprach niemand ein Wort. Dann hatte der Weihnachtsmann eine Idee. Er meinte, dass er an einem anderen Tag wiederkommen werde, um alles in Ruhe zu besprechen. Vielleicht tauche ja bis dahin auch mein Brief an ihn wieder auf. Mama war ganz entsetzt, dass Olli dem Weihnachtsmann ohne ihr Wissen geschrieben hatte, und meinte nur: „Mal schauen!“. Dann dankte sie dem Weihnachtsmann doch noch, dass er Olli wohlbehalten nach Hause gebracht hatte und während der wieder losfuhr, gingen sie ins Haus. Der Abend war alles andere als angenehm. Olli musste sich noch viele Vorwürfe seiner Mutter gefallen lassen, er hatte ein riesiges schlechtes Gewissen und als sie noch sein Elternheft sehen wollte, traute er sich nicht die Wahrheit zu sagen. - Hab ich vergessen, log er noch einmal. Er spürte, dass Mama ganz enttäuscht von ihm war. Sie hatte ihm auch gesagt, dass sie nun kein Vertrauen zu ihm habe und dass er ab sofort mit seinem großen Bruder gemeinsam nach Hause fahren müsse. Bis auf weiteres. Mikko hatte natürlich sofort protestiert: - Ich bin sicher kein Babysitter! Aber Mama war hart geblieben und so widersprach Mikko nicht weiter. Und auch Olli fügte sich Mamas Worten. Die Weihnachtsgeschichte für Jung & Alt ist in meinem Onlineshop als E-Book und als Hörbuch (zum Download oder als CD) sowie im Kombiangebot als E-Book und Hörbuch erhältlich! Es waren die ersten Tropfen seit Wochen. Bea konnte anfangs jedem einzelnen in ihrem Blickfeld folgen, sah den einen auf einem Blatt des Flieders landen und gleich darauf wieder in Richtung Rasen abrutschen, sah einen anderen auf einer der Waschbetonplatten des Gartenweges aufprallen, wo er einen kleinen dunklen Fleck hinterließ, sah einen weiteren den bemoosten Dachziegel netzen. Bald aber wusste sie nicht mehr, welchem der immer zahlreicher werdenden Regentropfen sie nachschauen sollte. Also schloss sie die Augen und lauschte dem Klang des dichter werdenden Regens, hörte dessen Tippen auf den Blättern der Linde über ihr, vernahm dessen Platschen am Fuße der undichten Dachrinne und folgte dessen Klimpern, das er an den Gläsern – eines leer, eines noch halb voll – verursachte. Simon war erst vor wenigen Minuten aufgebrochen, knapp vor Beginn dieses Wolkenbruchs, der sie nun zusehends durchnässte, obwohl sie unter dem dichten Blätterdach saß, das ihren Lieblingsplatz im Garten vor Sonne und normalerweise auch vor Niederschlag schützte. Die durch die Kleidung dringende Feuchtigkeit ließ sie frösteln. Es war ein wohliger Schauer, der ihren ganzen Körper erfasste, unbewusst griffen ihre Hände nach den Lehnen ihres Stuhls und ließen sie sich daran festhalten.
Ihr kurzes Haar fühlte sich an wie damals, als sie in ihrer Jugend regelmäßig mit ihrer Clique schon an den ersten wärmeren Frühlingstagen am Wasser gewesen war, um ihren Kopf neugierig unter dessen Oberfläche zu stecken. Nach dem Auftauchen waren ihr viele kleine Bächlein des Seewassers über die Stirn, die Nase und die Wangen geronnen. Manche von ihnen waren auf ihre Lippen zu gelaufen, wo sie sie einfach zum Spaß mit der Zunge abgeleckt hatte. Sie hatten anders geschmeckt als die Tropfen, die jetzt ihre Lippen berührten. Diese waren bitterer, so wie die Zeiten die sie jetzt durchlebte. Das mit der Süße der Jugend hatte offenbar doch seine Bewandtnis, dachte sie unvermittelt, ehe ihr der kräftige Geruch der mittlerweile durchfeuchteten Holzveranda in die Nase stieg. Wieder war sie zurückversetzt in längst Vergangenes und sah sich unter einem großen Badetuch sitzen mit Simon und den anderen. Rings um sie herum hatten die Himmel ihnen, den Gerechten, getaut und den von der an diesem Tag quälenden Sonne erhitzten Steg herrlich duftend langsam abgekühlt. Die Freiheit, die ihr damals vom Leben geschenkt worden war, war für sie selbstverständlich gewesen. Sie aber hatte immer noch mehr davon haben wollen, hatte tiefer hinein wollen und höher hinaus. Sie war schon als Kind bis zum Grund des Sees getaucht, zuerst bloß in Ufernähe, später in ihrer Jugend hatte sie sich dann von Simon hinausrudern lassen bis zu der Stelle, an der das Wasser laut den Einheimischen am tiefsten sein hatte sollen. Ganze zwei Minuten war sie da regelmäßig unter der Oberfläche gewesen, hatte mit kräftigen Tempi die Finsternis durchpflügt und das eine oder andere Mal auch etwas vom Grund mitgebracht. Einmal hatte sie sich an der Hand an einem rostigen, im Schlamm steckenden Metallteil geschnitten, den sie trotz höchsten Krafteinsatzes nicht bergen hatte können, wodurch seine Identität für immer im Dunkel blieb. Simon war wunderbar besorgt gewesen, hatte sie schnell aus dem Wasser ins Boot gezogen und dann ihre blutende Hand liebevoll in sein Handtuch gewickelt. Nur seiner Umarmung hatte sie sich schnell entziehen müssen. Die hatte sich unter diesen Umständen völlig unangemessen angefühlt. So schnell war er niemals zuvor und auch nur einmal danach zurück ans Ufer gerudert. Am Steg war sie prompt zu ihrer Großmutter losgelaufen, um sich von ihr verarzten zu lassen, die eingebundene Hand in die Höhe haltend um die Blutung weiterhin zu stoppen. Von da an war etwas anders gewesen in ihrem Verhältnis zu Simon, den sie schon seit Grundschultagen gekannt hatte. Die nächste Begegnung hatte sich so angefühlt, als wäre das Jetzt mit ihm dauerhaft und unangenehm beschattet. Dennoch war ihr dieser Simon trotzdem und trotz allem, was noch gefolgt war, bis in die Gegenwart geblieben; vor kurzem aber – nach dieser von ihr in einem Wirbel der Gefühle geäußerten und daher unbedachten Worte - war auch er gegangen. Die Heftigkeit seines Aufbruchs, die das Tischchen erzittern hatte lassen und die auf ihm befindlichen Gläser zum Vibrieren gebracht hatte, war ihr noch schmerzlich in Erinnerung. Der Schauder darüber, der ihr eine sie beengende Gänsehaut bescherte, ließ ihren Atem flacher werden. In diesem Augenblick stand zu befürchten, dass er diesmal für länger, wenn nicht für immer verschwunden war. Sie klammerte sich neuerlich an die Armlehnen ihres Stuhls. Warum nur musste es in diesen Situationen immer so enden, dass er ging? Vielleicht weil sie nicht zu gehen in der Lage war? Nicht mehr. Seither war immer er es gewesen, der sich von ihr entfernt hatte, mal schneller, mal langsamer, mal für kürzere, mal für längere Zeit. Aber nie hatte sie das Gefühl gehabt, dass es jetzt aus und vorbei wäre. Das war in diesem Moment anders. Der Regenschauer ließ langsam nach, seine Heftigkeit hatte den kleinen Gartentisch wie auch den Rasen rund um den Stamm in den Minuten ihres Nachsinnens mit einer Fülle an Lindenblüten bedeckt. Auch sie war von Kopf bis Fuß mit diesen duftenden Blättchen bedeckt. Sie strich sich durchs nasse Haar um es davon zu befreien. Da wurde sie plötzlich in jenen Moment nächster Nähe mit Simon zurückgeworfen, vor etwa 15 Jahren, knapp bevor ihr Leben die entscheidende Wendung genommen hatte, mit der sie sich bis heute nicht wirklich abzufinden vermochte. Damals an diesem Nachmittag am See war, als Simon sie nach einer ihrer Tauchgänge gerade zurück ans Ufer gerudert hatte, unvermittelt ein Gewitter losgebrochen. Sie erinnerte sich nicht mehr so genau, ob sie schon das Ufer erreicht hatten oder noch einige Meter draußen am Wasser gewesen waren, jedenfalls hatten sie noch im Boot gesessen. Der Blitz, dem sofort ein Donnerschlag gefolgt war, war einige Meter von ihnen entfernt in die Wasseroberfläche eingeschlagen und hatte ihren Kahn heftig zum Schaukeln gebracht. Simon und sie waren gleichzeitig aufgesprungen und hatten einander in die Arme genommen. Nach einer kurzen Schrecksekunde hatten sie ihre Umarmung gelöst und waren einander einige Zeit lang wortlos gegenüber gestanden. Dann war der Platzregen losgebrochen. Simon war wieder einen Schritt auf sie zugegangen und hatte ihr mit beiden Händen durchs Haar gestrichen. Sie hatte sich stante pede umgedreht, war über den Bootsrand gehüpft und Richtung Zuhause losgerannt. Simon hatte noch das Boot am Steg vertäut, bevor er ihre Verfolgung aufgenommen hatte. Als er bemerkt hatte, dass sie nicht stehen bleiben hatte wollen, war er aber zu sich nachhause gelaufen. Bea versuchte sich vom Garten ins Haus zu bewegen, der Regenguss aber hatte den Rasen so durchweicht, dass sie nicht von der Stelle kam. Sie fühlte sich in diesem Moment so hilflos wie nach ihrem Sturz, der ihr Leben in den Urzustand zurückkatapultiert hatte. Laut schrie sie nach Simon. Aber heute wie damals war er nicht für sie da. Tränen der Wut liefen ihr über die Wangen und sie bereute ihre Worte von vorhin genauso wie sie damals diesen schicksalhaften Flug bereut hatte. Mit ganzer Körperkraft versuchte sie sich aus ihrer ausweglos scheinenden Lage zu befreien, sie versuchte mit der ganzen Kraft ihrer Arme die Räder ihres Stuhls in Bewegung zu setzen. Doch da war nichts zu machen. Mit einer weiteren heftigen Bewegung ihres Oberkörpers fiel sie mitsamt ihrem Rollstuhl um und kam im nassen Rasen zu liegen. Da lag sie also rücklings wie Gregor Samsa in Kafkas Verwandlung nach seinem Erwachen im Körper eines Käfers und war bewegungsunfähig. So musste sie auch diesmal ausharren, denn Hilfe war weder in Hörweite noch in Sicht. Damals am Scheitelpunkt ihres alten Lebens war sie nach diesem Paragleiterflug, der sie hoch bis zur Sonne katapultiert hatte, und der in der Bö eines bevorstehenden Gewitters mit diesem Sturz aus rund 200 Höhenmetern geendet hatte, auf einer Futterwiese zu liegen gekommen. Niemand hatte ihren Sturz bemerkt und erst in der Dämmerung des nächsten Morgens hatte Simon sie gefunden. Er hatte sich schon am Abend auf die Suche gemacht und mit seinem Auto die ganze Nacht hindurch nach ihr Ausschau gehalten. Kurze Zeit später war sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert worden. Dennoch konnte ihre Querschnittlähmung vom 7. Brustwirbel abwärts nicht mehr verhindert werden. Sie schrie laut nach Simon, lag da am Rasen und ihr Herz raste vor Angst, ihr Leben nun endgültig verloren zu haben. Wie damals fühlte sie das pochenden Weh in ihrer Brust und die unendlich schmerzhafte Sehnsucht nach Leben. Ein nächster Wolkenbruch kam, Blitze zuckten, Donner grollte und Bea hielt sich beide Hände vor die Augen, um nicht sehen zu müssen, was da auf sie zukam, um auch nicht sehen zu müssen, was da hinter ihr lag. Da fühlte sie sich plötzlich von zwei starken Armen gepackt und hochgehoben. Sie öffnete die Augen. Simon. Er setze sie zurück in ihren Rollstuhl. Er strich ihr mit beiden Händen durchs nasse Haar. Er trocknete mit den Daumen seiner Hände die Tränen Ihrer Verzweiflung. Dann nahm er ihren Kopf zwischen seine Hände und küsste sie. Sein Kuss schmeckte so süß wie das Seewasser ihrer Jugend. Gerade geht der zweite dieser beiden Sommertage, die mich an damals sehr erinnern, in sein allerletztes Drittel. Der Morgen kühl mit um die 15 Grad, der Wind aus Westen, ja Nordwesten, die Sonne immer wieder hinter Wolken ... die Seele frisch, der Blick ganz klar, so der Verstand - bei höchstens Mitte zwanzig Celsius.
Im Herzen macht sich jene Sehnsucht breit, die nach Erfüllung heischt, doch weiß, dass nur ein Augenblick davon genug sein muss, ist es doch dieses Leben. Wenn es gelänge Augenblick an Augenblick zu fügen ohne den Blick zurück, auch ohne Zukunft, dann wäre viel gewonnen. Doch so erinnere ich mich trotz allen Sehnens so voller Sehnsucht meiner Kindheit, die sommers zwischen Alter Donau und Bergen in der Obersteiermark ihr Dasein lebte. Verlebte. Erlebte. Mit Großvater im Strandbad, dort im Fußballkäfig. Mit Mutter, auch mit Vater beschattet von der Veitsch, vom Niederalpl. Die erste Hälfte dieser Sommer gezeichnet von der Lebensfülle und voller Hoffnung; die zweite meist ein Abgesang, rann durch die Finger, geprägt vom nahenden Beginn des nächsten Aufenthalts im Schulgefängnis und Zuhause. Es dämmerte schon früh in diesen Tagen. Davor oft auch die widerliche Schwüle, die viel zu selten von Gewittern mir heftig von der Haut gewaschen wurde. Wie fürchtete ich diese Wetter überall, noch mehr im Bergland. Sie zeigten mir die Macht des viel zu lange Unterdrückten. Und dann: Der Duft von Futterwiesen, Sommerblumen, dem Wasser und der Sonne auf der Haut. Der Klang von Morgenvögeln, dem Wind in Buchen, Tannen, Föhren, der Stimme jenes Baches, an dem ich mich verliebte. Und im Geschmack des süßen Klees verging so manche bittere Stunde schneller. Da spürte ich die Wiesen, durch die ich nicht nur lief, sondern auch rollte, noch lange nachher - ganz tief im Innern unter meiner Haut. Und sah die blauen Himmel besser und griff begierig nach dem tiefen Sinn des Lebens. Zwei Sommertage so wie damals - und ich bin wieder mitten drin im Sein. Ist eine Wonne. Dieser Text ist auch im Tagebuch unter "#73/16: Zwei Sommertage wie damals" zu finden. Da stehe ich nun, zum ersten Mal nach langer Zeit im Zimmer meines Vaters und habe immer noch das schlechte Gewissen, das mich jedesmal befallen hat, wenn ich mich ohne seine Erlaubnis in diesen für ihn heiligen Raum gewagt habe. Auch wenn ich in meiner Kindheit versucht hätte, seine Zustimmung zu meinen Entdeckungsreisen durch seine Lande zu bekommen, ich wäre jedesmal gescheitert. An das Seine hat er niemanden herangelassen. Selbst meine Mutter, die dort für ihn sauber machen hat müssen, hat jedesmal die Bürde dieser ihr von ihm auferlegten Aufgabe zu spüren bekommen. Auf diese Weise hat sie sich jedes Mal auch der Gefahr aussetzen müssen, dass er etwas auszusetzen hatte, weil sein Fauteuil zu weit rechts stand, seine Brille an der falschen Schreibtischseite lag oder Unterlagen unauffindbar waren, die er doch ganz bestimmt an diese oder jene Stelle gelegt hatte.
Ich habe also auch jetzt seine Erlaubnis nicht, spüre das Aufkeimen dieses schlechten Gewissens, es beginnt wie dazumal mit dieser Anspannung in der Bauchdecke, steigt dann mit einem Kribbeln in die Magengegend, nimmt mir den freien Atem und würgt mich an der Kehle, ehe es sich als Hitze in Wangen, Ohren und Stirn festsetzt und dort noch länger bleibt als die Tat dauert, die ich begangen habe. Alles ist immer am gleichen Platz wie in den Jahren meiner Kindheit, obwohl alles doch so anders geworden ist. Sein Fauteuil ist einem Lehnstuhl gewichen, der auch eine Fußstütze hat. Sein Schreibtisch ist nicht mehr der Teil des Esstisches sondern ein kleiner Sekretär, der dort steht. Dafür ist der Esstisch gewichen und in die andere Hälfte des Wohnzimmers übersiedelt, dort wo früher die Couch und der Sofatisch standen. Am Schreibtisch selbst liegt alles in gewohnter Ordnung, auch seine Schreibmaschine steht da, einen Bogen Papier eingespannt, so als wäre er nur eine Runde ums Haus unterwegs um kurz nachzudenken, wie er seinen Einfall am besten aufs Papier bringen könnte. Ich tippe gedankenverloren ein “P”, sofort zuckt der Zeigefinger meiner rechten Hand zurück, ich blicke über die linke Schulter nach hinten, die Hitze ist längst auf der Stirn angekommen. Schnell bereinige ich meinen Fauxpas mit der Korrekturtaste. Da fällt mein Blick auf ein Kuvert mit meinem Namen. Unsere letzte, rein zufällige Begegnung fällt mir ein. Das war erst vor wenigen Wochen gewesen, da sah ich ihn im Schlepptau meiner Mutter durch die Einkaufsstraße schlurfen. Er wirkte wie ihr Hündchen, sein Marionettendasein war mir noch nie so offensichtlich geworden wie in diesem Augenblick. Einerseits hatte sie sich zeit meines Lebens regelmäßig bei mir über ihn beschwert, über seine Art, seinen Zigaretten- und Alkoholkonsum, seinen Umgang mit ihr, seine Lieblosigkeit und seine Wutanfälle. Andererseits hatte sie ihn jedesmal für dieselben Eigenarten vor anderen verteidigt und alle um Verständnis ersucht. Jedenfalls wollte sie ihr Leben in der Öffentlichkeit als ein ihm geopfertes darstellen - und doch ahnte ich, dass sie äußerst subtil mit ihrer Macht über ihn spielte und mich und die anderen damit gnadenlos manipulierte. Doch ich traute schon damals meinen Gefühlen nicht oder nicht mehr. Ich nehme das Kuvert an mich, wende es. Es ist zugeklebt. Ich möchte es umgehend aufreißen, da er doch nicht mehr ist. Nach einem kurzen Zögern lege es wieder an seinen Platz zurück. Ich verlasse mein Elternhaus, schlage die Tür zum letzten Mal mit solcher Wucht hinter mir zu, dass die Nachbarin, die mir die Wohnung aufgesperrt hat und davor wartet, richtiggehend zusammenzuckt, murmle ihre eine Verabschiedung zu und laufe den Atem anhaltend die fünf Treppen so schnell ich kann abwärts. Auf der Straße empfängt mich an diesem Oktobertag frühlingshaft warme Sonne. Mein erster Atemzug ... |
Kategorien
Alle
Text-Archiv
Februar 2021
|
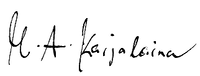
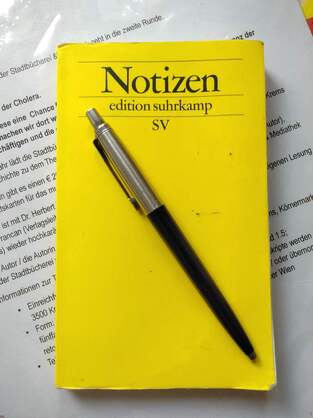




 RSS-Feed
RSS-Feed
